|
Was ist Archäologie?
Die Archäologie beschäftigt sich mit den Hinterlassenschaften der Menschen und stellt diesen zusammen mit seiner Kultur und Umwelt im Laufe seiner geschichtlichen Entwicklung dar.
Sie bedient sich hierbei verschiedener Mittel und Methoden, um die Umwelt und das Leben unserer Vorfahren zu rekonstruieren. |
1.
Ausgrabung
 ie Technik, durch die der Archäologe Materialreste vergangener Zeiten unter der Erdoberfläche ortet und freilegt. Mit der Zeit entwickelten die Wissenschaft immer sorgfältigere Methoden. Heute dienen Grabungen nicht nur dazu, den Bedarf von Sammlern oder Museen zu decken. Vielmehr werden mit ihrer Hilfe Antworten auf ganz bestimmte Fragen gesucht. Die Fundsuche bedrohen in jüngster Zeit immer mehr um sich greifende Bauvorhaben wie Strassen- und Hausbau, Tiefgaragen, Untergrundbahnen usw. Immer mehr im Boden befindliche Überreste der Vergangenheit werden dadurch zerstört, so dass sich ein ganz auf Notgrabungen spezialisierter Archäologenzweig herausgebildet hat, dessen einziger Zweck die
Bergung möglichst umfangreichen Materials und die Erfassung möglichst vieler bedrohter Stätten ist, bevor sie auf immer für die Wissenschaft verloren sind. Das Ziel der Archäologen besteht aber nicht nur darin, Objekte zu finden und zu bergen, sondern es gilt auch, die genaue Lage der einzelnen Funde im Verhältnis zu anderen Objekten innerhalb derselben Schicht sowie zu anderen Schichten zu bestimmen ie Technik, durch die der Archäologe Materialreste vergangener Zeiten unter der Erdoberfläche ortet und freilegt. Mit der Zeit entwickelten die Wissenschaft immer sorgfältigere Methoden. Heute dienen Grabungen nicht nur dazu, den Bedarf von Sammlern oder Museen zu decken. Vielmehr werden mit ihrer Hilfe Antworten auf ganz bestimmte Fragen gesucht. Die Fundsuche bedrohen in jüngster Zeit immer mehr um sich greifende Bauvorhaben wie Strassen- und Hausbau, Tiefgaragen, Untergrundbahnen usw. Immer mehr im Boden befindliche Überreste der Vergangenheit werden dadurch zerstört, so dass sich ein ganz auf Notgrabungen spezialisierter Archäologenzweig herausgebildet hat, dessen einziger Zweck die
Bergung möglichst umfangreichen Materials und die Erfassung möglichst vieler bedrohter Stätten ist, bevor sie auf immer für die Wissenschaft verloren sind. Das Ziel der Archäologen besteht aber nicht nur darin, Objekte zu finden und zu bergen, sondern es gilt auch, die genaue Lage der einzelnen Funde im Verhältnis zu anderen Objekten innerhalb derselben Schicht sowie zu anderen Schichten zu bestimmen |
2. Bandkeramik-Kulturen:
 o genannt nach den bänderartigen Ritzungen auf ihren Gefäßen benannte Kultur. Diese Kultur repräsentieren die frühesten landwirtschaftlich orientierten Gesellschaftsverbände in Mitteleuropa, die sich etwa in den Jahrhunderten ab Mitte des 5. Jt. s v. Chr. in kurzer Zeit von der mittleren Donau an den mittleren Rhein ausbreitete. Die Siedlungen liegen auf den Löss-Böden der grossen Flusstäler und bestehen aus massiven, oft trapezförmigen Langhäusern. Eine der bekanntesten bandkeramischen bzw. Donaukultur-Siedlungen wurde in Köln-Lindenthal ausgegraben. o genannt nach den bänderartigen Ritzungen auf ihren Gefäßen benannte Kultur. Diese Kultur repräsentieren die frühesten landwirtschaftlich orientierten Gesellschaftsverbände in Mitteleuropa, die sich etwa in den Jahrhunderten ab Mitte des 5. Jt. s v. Chr. in kurzer Zeit von der mittleren Donau an den mittleren Rhein ausbreitete. Die Siedlungen liegen auf den Löss-Böden der grossen Flusstäler und bestehen aus massiven, oft trapezförmigen Langhäusern. Eine der bekanntesten bandkeramischen bzw. Donaukultur-Siedlungen wurde in Köln-Lindenthal ausgegraben. |
3. Amphitheater:
 us griech. amphi
(doppel-, auch beidseitig bzw. herum) und theatron (Schauplatz) Wörtl. also ein Doppeltheater, das um den Schauplatz der Darbietungen herum gebaut ist, so dass man das
Dargebotene von beiden Seiten betrachten kann. us griech. amphi
(doppel-, auch beidseitig bzw. herum) und theatron (Schauplatz) Wörtl. also ein Doppeltheater, das um den Schauplatz der Darbietungen herum gebaut ist, so dass man das
Dargebotene von beiden Seiten betrachten kann. |
4.
Neolithikum:
 ungsteinzeit ,
Wesensmerkmale der westlichen Kultur sind Ackerbau und Viehzucht, Sesshaftigkeit in ortsfesten Siedlungen dörflichen Charakters, neuer Rodungsverfahren und Keramik. ungsteinzeit ,
Wesensmerkmale der westlichen Kultur sind Ackerbau und Viehzucht, Sesshaftigkeit in ortsfesten Siedlungen dörflichen Charakters, neuer Rodungsverfahren und Keramik.
|
5.
Krakeliert:
 etzt man Silex dem
Feuer aus, so verändert sich seine Oberfläche, sie wird matt und weiß. Diese Veränderung bezeichnet man als Krakelierung etzt man Silex dem
Feuer aus, so verändert sich seine Oberfläche, sie wird matt und weiß. Diese Veränderung bezeichnet man als Krakelierung
|
7.
Patina:
 ls Patina bezeichnet
man die durch Einflüsse der Lagerung im Boden entstandenen Veränderungen der Oberflächenfärbung von Feuersteinstücken ls Patina bezeichnet
man die durch Einflüsse der Lagerung im Boden entstandenen Veränderungen der Oberflächenfärbung von Feuersteinstücken
|
8.
Feuersteinvorkommen, regional:
 assiertes Vorkommen
ist erst rund 20 km entfernt auf den Hauptterrassenflächen der Süchtelner Höhen bekannt. assiertes Vorkommen
ist erst rund 20 km entfernt auf den Hauptterrassenflächen der Süchtelner Höhen bekannt.
|
9.
Denkmalschutzgesetz:
 enkmalschutzgesetze sind die Grundlage
der archäologischen Denkmalspflege. Sie legen fest, was ein archäologisches Denkmal ist, schreiben das Verfahren der Unterschutzstellung der Denkmäler vor und sichern den
mit der archäologischen Denkmalspflege befassten Ämtern bzw. Behörden die Möglichkeit einer Beeinflussung aller Planungen zu, die mit Eingriffen in den Boden verbunden
sind. enkmalschutzgesetze sind die Grundlage
der archäologischen Denkmalspflege. Sie legen fest, was ein archäologisches Denkmal ist, schreiben das Verfahren der Unterschutzstellung der Denkmäler vor und sichern den
mit der archäologischen Denkmalspflege befassten Ämtern bzw. Behörden die Möglichkeit einer Beeinflussung aller Planungen zu, die mit Eingriffen in den Boden verbunden
sind.
|
10. Löß:
 öß ist ein vom Wind verfrachteter Flugstaub. Der in Mitteleuropa
abgelagerte Löß stammt aus dem Pleistozän (Eiszeitalter). Dort wurde er
aus den vegetationslosen Schotter- und Sanderflächen ausgeblasen. Die
Mächtigkeit der Ablagerungen und die Korngrößen nehmen mit der
Entfernung zum Liefergebiet ab. Die Ablagerung erfolgt meistens vor
Mittelgebirgsschwellen. So gibt es in Deutschland die mächtigsten
Lößschichten nördlich der Mittelgebirge in den so genannten Börden
(Auswehung aus den nördlichen Vereisungs- und Periglazialgebieten), im
Rheintal und im Voralpenland. Die in Süddeutschland sedimentierten
Schichten sind aufgrund des Liefergebiets (Kalkalpen) sehr
carbonatreich. Hier werden Werte bis 35 Prozent erreicht. Die
Mächtigkeiten erreichen in Mitteleuropa maximal 40 Meter. Löß ist ein
fruchtbarer Ackerboden der hohe landwirtschaftliche Erträge erbringt. öß ist ein vom Wind verfrachteter Flugstaub. Der in Mitteleuropa
abgelagerte Löß stammt aus dem Pleistozän (Eiszeitalter). Dort wurde er
aus den vegetationslosen Schotter- und Sanderflächen ausgeblasen. Die
Mächtigkeit der Ablagerungen und die Korngrößen nehmen mit der
Entfernung zum Liefergebiet ab. Die Ablagerung erfolgt meistens vor
Mittelgebirgsschwellen. So gibt es in Deutschland die mächtigsten
Lößschichten nördlich der Mittelgebirge in den so genannten Börden
(Auswehung aus den nördlichen Vereisungs- und Periglazialgebieten), im
Rheintal und im Voralpenland. Die in Süddeutschland sedimentierten
Schichten sind aufgrund des Liefergebiets (Kalkalpen) sehr
carbonatreich. Hier werden Werte bis 35 Prozent erreicht. Die
Mächtigkeiten erreichen in Mitteleuropa maximal 40 Meter. Löß ist ein
fruchtbarer Ackerboden der hohe landwirtschaftliche Erträge erbringt.
|
11. Altsteinzeit / Paläolithikum:
 bschnitt der Vorgeschichte.( nach palaiós
= alt und líthos = Stein). Zusammen mit dem Neolithikum (der Jungsteinzeit) bildet das Paläolithikum die Steinzeit, die der Bronze- und Eisenzeit vorausgeht.
Ursprünglichcharakterisierte man das P. als Periode steinerner Abschlaggeräte im Gegensatz zu den geschliffenen Steingeräten des
Neolithikum; zu den im Paläolithikum
lebenden Tieren zählen die ausgestorbenen Arten Mammut und Wollnashorn, aber auch zurückgedrängte Arten wie Rentier, Moschusochse und Flusspferd. Herkömmlicherweise
unterteilt man das Paläolithikum seinerseits in Alt-, Mittel- und Jungpaläolithikum. bschnitt der Vorgeschichte.( nach palaiós
= alt und líthos = Stein). Zusammen mit dem Neolithikum (der Jungsteinzeit) bildet das Paläolithikum die Steinzeit, die der Bronze- und Eisenzeit vorausgeht.
Ursprünglichcharakterisierte man das P. als Periode steinerner Abschlaggeräte im Gegensatz zu den geschliffenen Steingeräten des
Neolithikum; zu den im Paläolithikum
lebenden Tieren zählen die ausgestorbenen Arten Mammut und Wollnashorn, aber auch zurückgedrängte Arten wie Rentier, Moschusochse und Flusspferd. Herkömmlicherweise
unterteilt man das Paläolithikum seinerseits in Alt-, Mittel- und Jungpaläolithikum.
|
12. Jungpaläolithikum:
 as Jungpaläolithikum ist durch steinerne
Klingen gekennzeichnet. Jungsteinzeitliche Assemblagen (Ansammlung bestimmter Gegenstände bestimmter Art) lassen sich mit Hilfe der Radiokarbondatierung 35 000 bis 45 000
Jahre vor der Gegenwart zurückverfolgen. Von der vorhergehenden Phase unterscheidet sich das Jungpaläolithikum durch Knochenwerkzeuge sehr bestimmter Art; desgl. durch
seine Hohlenkunst. as Jungpaläolithikum ist durch steinerne
Klingen gekennzeichnet. Jungsteinzeitliche Assemblagen (Ansammlung bestimmter Gegenstände bestimmter Art) lassen sich mit Hilfe der Radiokarbondatierung 35 000 bis 45 000
Jahre vor der Gegenwart zurückverfolgen. Von der vorhergehenden Phase unterscheidet sich das Jungpaläolithikum durch Knochenwerkzeuge sehr bestimmter Art; desgl. durch
seine Hohlenkunst.
|
14. Experimentelle Archäologie:
 ie klassischen archäologischen und geschichtswissenschaftlichen Methoden gewinnen ihre Erkenntnisse durch Beobachtung und Interpretation von Funden und Fundstätten. Die experimentelle Archäologie versucht diese Erkenntnisse durch Erfahrungswerte zu vertiefen. ie klassischen archäologischen und geschichtswissenschaftlichen Methoden gewinnen ihre Erkenntnisse durch Beobachtung und Interpretation von Funden und Fundstätten. Die experimentelle Archäologie versucht diese Erkenntnisse durch Erfahrungswerte zu vertiefen.
Anhand von Fundstücken, Malereien und Texten wird versucht die Arbeitstechniken der Vergangenheit zu erschließen. Diese Erkenntnisse werden dann von Archäologen und Handwerkern angewandt, um Artefakte nachzubilden, die ihren historischen Vorgängern möglichst ähnlich sind. In der Anwendung dieser Nachbildungen wird der technische Stand vergangener Epochen erfahrbar.
|
Schifffahrt
|
1. Treideln:
 n der Flussschifffahrt das Vorwärtsziehen eines an einer Leine befestigten
Schiffes oder Bootes auf Bergfahrt vom Ufer aus auf den Treidelpfad durch die Kraft von Pferden oder Rindern. n der Flussschifffahrt das Vorwärtsziehen eines an einer Leine befestigten
Schiffes oder Bootes auf Bergfahrt vom Ufer aus auf den Treidelpfad durch die Kraft von Pferden oder Rindern.
|
2. Achterspant:
 interer Spant im Sinne der Fahrtrichtung. interer Spant im Sinne der Fahrtrichtung.
|
3. Mastspur:
 usnehmung im Kiel zum
Einsetzen des Mastfußes, oft auch Spurbeschläge, die ein geringes
Versetzen des Mastes in Kielrichtung ermöglichen. Die Mastspur kann auch
auf Deck angebracht sein, wenn dieses ausreichend stark konstruiert
worden ist. usnehmung im Kiel zum
Einsetzen des Mastfußes, oft auch Spurbeschläge, die ein geringes
Versetzen des Mastes in Kielrichtung ermöglichen. Die Mastspur kann auch
auf Deck angebracht sein, wenn dieses ausreichend stark konstruiert
worden ist. |
4. Treidelleine:
 ennt man die Leine an der
ein Schiff am sogenannten Treidelmast an einem einem Fluss- oder
Kanalufer längs geschleppt wird. ennt man die Leine an der
ein Schiff am sogenannten Treidelmast an einem einem Fluss- oder
Kanalufer längs geschleppt wird.
|
5. Staken:
 as Bewegen eines Fahrzeugs
durch Abstoßen vom Grund mittels Riemen, Bootshaken u. ä. as Bewegen eines Fahrzeugs
durch Abstoßen vom Grund mittels Riemen, Bootshaken u. ä.
|
6. Setzbord:
 retter zum Erhöhen der
Bordwand (z.B. um eine leichte Ladung unterzubringen bzw. um zu
verhindern, dass bei offenem Laderaum das Wasser hineinschlägt; früher
auch, um - nachdem es herausgenommen worden war - die Kohle über ein
niedrigeres Bord leichter aus dem Laderaum hinausschaffen zu können). retter zum Erhöhen der
Bordwand (z.B. um eine leichte Ladung unterzubringen bzw. um zu
verhindern, dass bei offenem Laderaum das Wasser hineinschlägt; früher
auch, um - nachdem es herausgenommen worden war - die Kohle über ein
niedrigeres Bord leichter aus dem Laderaum hinausschaffen zu können). |
7. Dollbord:
 berer Rand eines Bootes. Im Dollbord eines Bootes befinden sich Dollen
(Rindergabeln), die als Auflage- und Drehpunkt für einen Riemen dient. Eine einfache Dolle
kann aus zwei Holzpflöcken bestehen, die im Dollbord stecken berer Rand eines Bootes. Im Dollbord eines Bootes befinden sich Dollen
(Rindergabeln), die als Auflage- und Drehpunkt für einen Riemen dient. Eine einfache Dolle
kann aus zwei Holzpflöcken bestehen, die im Dollbord stecken
|
8. Riemen:
 aienhaft Ruder genannt. Ein bis mehrere Schritt langes Rundholz mit Blatt,
das zum Pullen benutzt wird. Ein kleiner Riemen ist ein Paddel. aienhaft Ruder genannt. Ein bis mehrere Schritt langes Rundholz mit Blatt,
das zum Pullen benutzt wird. Ein kleiner Riemen ist ein Paddel. |
9. Streichruder:
 as Ruder in seiner einfachsten Form ist ein langer Riemen oder
Streichruder. Ruderblatt, -schaft und -pinne bilden darin eine Einheit. Die Pinne ist lediglich die Verlängerung des Blatts, das vom Deck des Hinterschiffs aus in seinem
Lager sowohl seitlich hin und her als auch auf und ab bewegt werden kann. Damit verfügt solch ein einfacher Riemen schon über die wesentliche Funktion eines Ruders, das den
Strom seitlich ablenkt und diese Energie mittels der Lagerung auf den Schiffskörper überträgt. Durch die zusätzliche Beweglichkeit des Ruders in der Vertikalen lässt sich
zusätzlich die Hebelwirkung des Ruders verändern, wodurch sich nicht nur der Kraftaufwand des Rudergängers, sondern auch der Wirkungsgrad des Ruders selbst durch Heben und
Senken des Blatts erhöhen und vermindern lässt. as Ruder in seiner einfachsten Form ist ein langer Riemen oder
Streichruder. Ruderblatt, -schaft und -pinne bilden darin eine Einheit. Die Pinne ist lediglich die Verlängerung des Blatts, das vom Deck des Hinterschiffs aus in seinem
Lager sowohl seitlich hin und her als auch auf und ab bewegt werden kann. Damit verfügt solch ein einfacher Riemen schon über die wesentliche Funktion eines Ruders, das den
Strom seitlich ablenkt und diese Energie mittels der Lagerung auf den Schiffskörper überträgt. Durch die zusätzliche Beweglichkeit des Ruders in der Vertikalen lässt sich
zusätzlich die Hebelwirkung des Ruders verändern, wodurch sich nicht nur der Kraftaufwand des Rudergängers, sondern auch der Wirkungsgrad des Ruders selbst durch Heben und
Senken des Blatts erhöhen und vermindern lässt. |
|
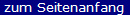 |