|


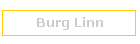


















| |
|
Römische Münzen
Die Technik der Münzherstellung |
|
| |
| |
Blech, Schrötling und Münze
von Detlef Stender
Herstellung von
Kupfermünzen
 ls erstes
wird aus einem Kupferrohling welcher gußtechnich hergestellt wurde, ein
Blech hergestellt. Dieses Blech kann durch Auswalzen oder aber auch
durch Treiben mit einem Hammer auf die notwendige Dicke getrieben werden
(Abb. 1). Da das Blech nach jedem Hammerschlag eine
Kaltverformung erleidet und daher härter wird, muss es mehrfach durch
Zwischenglühen wieder weich gemacht werden. ls erstes
wird aus einem Kupferrohling welcher gußtechnich hergestellt wurde, ein
Blech hergestellt. Dieses Blech kann durch Auswalzen oder aber auch
durch Treiben mit einem Hammer auf die notwendige Dicke getrieben werden
(Abb. 1). Da das Blech nach jedem Hammerschlag eine
Kaltverformung erleidet und daher härter wird, muss es mehrfach durch
Zwischenglühen wieder weich gemacht werden.
Mit einer Schere wird das Blech zunächst in Streifen und anschließend in
Quadrate geschnitten. Wenn die Ecken entfernt werden erhält man eine
fast runde Scheibe, die ein genau definiertes Gewicht haben sollte.
Diese Scheibe wird auch als Schrötling bezeichnet.
(Abb. 2)
Ein Schrötling ist der Rohling einer Münze, also ein schon in Münzform
gebrachtes Metallstück oder ein Metallklümpchen, aus dem die Münze
geschlagen wird.
Ein Stempelschneider erstellte als nächstes ein negatives plastisches
Bild in den metallenen Prägestock.
Mit einem Hammer und zwei Prägestöcken schlug man beidseitig Motive in
den Schrötling. Einer der Prägestöcke wurde in einen Halter gespannt,
Rohling und zweiter Prägestock aufgelegt und dann gehämmert.
(Abb. 3)

Der im rechten Bild gezeigte römische Münzprägestempel wurde bei Ausgrabungen in
Augst gefunden.
Mit seiner achteckigigen konisch zulaufenden Form wurde er aller
wahrscheinlich nach in einem Amboss festgehalten. Auch kann man davon
ausgehen, das der Prägestempel Oberflächengehärtet wurde. Dadurch konnte
der Verschleiß des Stempels beim Prägen erheblich herabgesetzt werden.
(Abb. 4)
|
|
 |
|
Römische
Münzen
 ie
Münzstätte ist der Ort, an dem die Münzen geprägt werden. Es haben sich
viele andere Namen dafür herausgebildet, so Prägestätte, Münzschmiede
und Prägeort. ie
Münzstätte ist der Ort, an dem die Münzen geprägt werden. Es haben sich
viele andere Namen dafür herausgebildet, so Prägestätte, Münzschmiede
und Prägeort. In einer Münzstätte sind oft Planung, Herstellung und Auslieferung der
Münzen in einer Hand vereinigt. Im Laufe der Geschichte ist es die Regel
gewesen, dass die Prägung zentral organisiert wurde. Bei den
Sasaniden (224-650 n. Chr.) ging die Gängelung sogar so weit, dass
selbst der Stempelversand von der Obrigkeit angeordnet wurde.
Im allgemeinen waren Münzstätten jedoch recht eigenständig.
Geordnete Staatswesen brauchen vertrauenswürdiges, qualititativ gleich
emittiertes Münzgeld. |
|
|
Abb. 1
Treibarbeiten zur Blechherstellung |
|
 |
|
Abb. 2
Herstellung des Schrötling |
|
 |
|
Abb. 3
Der Prägevorgang |
 |
|
Abb. 4
Seitenansicht des unteren Teils eines römischen Münzprägestempels aus Augst, Höhe: 6,5 cm |
Eine römische Münzprägestätte
Tetricus Lokale Münzprägung des 3. Jahrh. im Hambacher Forst
von Volker Zedelius
 m letzten
Sonderheft "Das Rheinische Landesmuseum - Ausgrabungen im Rheinland 77,
vom August 1978, 5. 127 f. wurde bereits auf einen bisher im Rheinland
einmaligen Fund hingewiesen, der m. W. auch sonst bis jetzt ohne
Parallele Ist. Im Rheinischen Braunkohlen-Revier, im Hambacher Forst,
entdeckten Archäologen nun neuerdings bei der Ausgrabung des römischen
Gutshofes ( villa rustica) Ha 56
das, was der numismatischen Forschung bis zu dieser Zeit gefehlt hat:
Die Überreste einer „Heimprägung". Angesichts der gewaltigen Masse von
Nachprägungen von Münzen des 3. Jahrhunderts
im sog. Gallischen Sonderreich bestand freilich immer
schon die Hoffnung, eines Tages auf die Spuren einer Werkstatt, Schmiede
oder einer Anlage zur privaten Münzproduktion zu stoßen. m letzten
Sonderheft "Das Rheinische Landesmuseum - Ausgrabungen im Rheinland 77,
vom August 1978, 5. 127 f. wurde bereits auf einen bisher im Rheinland
einmaligen Fund hingewiesen, der m. W. auch sonst bis jetzt ohne
Parallele Ist. Im Rheinischen Braunkohlen-Revier, im Hambacher Forst,
entdeckten Archäologen nun neuerdings bei der Ausgrabung des römischen
Gutshofes ( villa rustica) Ha 56
das, was der numismatischen Forschung bis zu dieser Zeit gefehlt hat:
Die Überreste einer „Heimprägung". Angesichts der gewaltigen Masse von
Nachprägungen von Münzen des 3. Jahrhunderts
im sog. Gallischen Sonderreich bestand freilich immer
schon die Hoffnung, eines Tages auf die Spuren einer Werkstatt, Schmiede
oder einer Anlage zur privaten Münzproduktion zu stoßen.
Innerhalb eines fast mannshohen, rechteckigen Kellers aus Tuffsteinen
mit Nischen
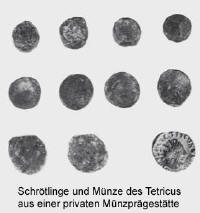 und Lichtschächten in dieser Villa, fand man zunächst an der
Südseite einzelne ziemlich regelmäßig runde, flache Metallscheiben
(siehe Bild links) die
im Münzkabinett Bonn als Schrötlinge erkannt wurden, eine daraufhin
veranlasste gezielte Nachuntersuchung erbrachte in einer vor der
westlichen Stirnwand in den Kellerestrich eingetieften, holzverschalter
Grube die Masse dieser münztechnisch und geldgeschichtlichen, so
bedeutsamen Objekte. Auf Grund der bis jetzt durch die Reinigung und
Konservierung gegangenen Stücke lässt sich sagen: Das Material besteht
überwiegend aus Barrenteilen und Schrötlingen aus Bronze, die zusammen
fast 3 kg ausmachen Geprägte Münzen wurden bisher nur 80 Stück gezählt.
Über die Beschaffung des Rohmaterials sind derzeit noch keine Aussagen
möglich. Die gefundenen Objekte erlauben folgende Angaben zur
Herstellungstechnik und geben über den Ablauf der Vorarbeiten
detailliert Auskunft: und Lichtschächten in dieser Villa, fand man zunächst an der
Südseite einzelne ziemlich regelmäßig runde, flache Metallscheiben
(siehe Bild links) die
im Münzkabinett Bonn als Schrötlinge erkannt wurden, eine daraufhin
veranlasste gezielte Nachuntersuchung erbrachte in einer vor der
westlichen Stirnwand in den Kellerestrich eingetieften, holzverschalter
Grube die Masse dieser münztechnisch und geldgeschichtlichen, so
bedeutsamen Objekte. Auf Grund der bis jetzt durch die Reinigung und
Konservierung gegangenen Stücke lässt sich sagen: Das Material besteht
überwiegend aus Barrenteilen und Schrötlingen aus Bronze, die zusammen
fast 3 kg ausmachen Geprägte Münzen wurden bisher nur 80 Stück gezählt.
Über die Beschaffung des Rohmaterials sind derzeit noch keine Aussagen
möglich. Die gefundenen Objekte erlauben folgende Angaben zur
Herstellungstechnik und geben über den Ablauf der Vorarbeiten
detailliert Auskunft:
1. Das Rohmaterial eine offensichtlich homogene Kupferlegierung
(aes/Bronze)
 wurde zu stabförmigen Barren gegossen. Diese Barren
mit rundem Querschnitt und konisch zulaufenden Enden sind nur in
gestückelter Form erhalten. Daher sind Angaben zu Ihrer Länge nicht
möglich. Sie hatten einen Standarddurchmesser von 8—9 mm. wurde zu stabförmigen Barren gegossen. Diese Barren
mit rundem Querschnitt und konisch zulaufenden Enden sind nur in
gestückelter Form erhalten. Daher sind Angaben zu Ihrer Länge nicht
möglich. Sie hatten einen Standarddurchmesser von 8—9 mm.
2. Die Barren wurden, wohl leicht erhitzt, von zwei Arbeitern in
im Mittel 8 x 8 mm messende zylindrische Bronze-Stückchen
zerlegt, dabei wurde der Barren mit einer längsgerieften Flachzange
festgehalten und mit einer kräftigen Beißzange wurden die einzelnen
Stücke abgetrennt. Viele dieser Barrenstücke tragen außen deutlich die
Zangenspuren und an den Trennungsflächen außer den Schnittspuren auch
Bruchspuren.
3. Die ziemlich regelmäßig gestückelten Bronzezylinder wurden
anschließend offensichtlich in mindestens zwei Arbeitsgängen und
möglicherweise wieder erhitzt flachgehämmert. Bis zum flachen, glatten
Schrötling lassen sich mehrere unterschiedlich starke Zwischengrößen
nachweisen. Ein sehr großer Teil jener „Vorschrötlinge" Ist beim
Flachhämmern zersprungen; einerseits ist dies eine Folge des durch
Abbrechen entstandenen unregelmäßigen Reliefs der Trennungsflächen, das
bei einem glatten Sägeschnitt nicht entstanden wäre; anderseits ist dies
wohl auf zu sprödes Material oder ungenügendes Erhitzen zurückzuführen.
4. Die Schrötlinge wurden in der herkömmlichen Weise,
genau wie in offiziellen Prägestätten. zwischen Ober- und
Unterstempel geprägt. Bei diesem letzten mechanischen Arbeitsgang
ist wiederum ein Teil gerissen oder gesprungen.
Dass in Ha 56 nicht nur Schrötlinge produziert, sondern hier auch
wirklich geprägt wurden, beweißt das massierte Auftreten von
Stempelidentitäten bei den wenigen Münzen. Sie geben Aufschluss darüber,
wie viele Prägeeisen am Ort mindestens in Betrieb waren. Man hat
wenigstens mit 8 Stempeln (=4 Stempelpaaren) hier gearbeitet.
|
|
zurück zur Übersicht
|
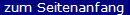 |
|