|


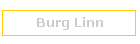


















| |
|
 1 Die
Lage der Villa 1 Die
Lage der Villa
 2 Lageplan 2 Lageplan
 3 Konzept 3 Konzept  4 Küche 4 Küche  5 Vorratsraum 5 Vorratsraum  6 Caupona 6 Caupona  7 Porticus 7 Porticus  8 Ostansicht 8 Ostansicht  9 Thermen 9 Thermen
 10 Die
Wasserhebeanlage 10 Die
Wasserhebeanlage
 11 VR-
virtual reality der Römervilla
11 VR-
virtual reality der Römervilla
 12 Raum
6
12 Raum
6 |
Die virtuelle Rekonstruktion der "Villa Ahrweiler"
Eine
archäologische Herausforderung!.
|
|
|
| |
Vorwort:
Durch den Kontakt mit dem Museum in Ahrweiler entstand das
Vorhaben.
 ie Römervilla von Bad Neuenahr-Ahrweiler am Silberberg ist ein
archäologischer Fundplatz,
der eine jahrhundertelange wechselnde Nutzung von der Mitte des ersten
nachchristlichen Jahrhunderts bis ins Frühmittelalter dokumentiert.
Das ergrabene Areal befindet sich am Rand der rheinland-pfälzischen
Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler im Landkreis Ahrweiler. ie Römervilla von Bad Neuenahr-Ahrweiler am Silberberg ist ein
archäologischer Fundplatz,
der eine jahrhundertelange wechselnde Nutzung von der Mitte des ersten
nachchristlichen Jahrhunderts bis ins Frühmittelalter dokumentiert.
Das ergrabene Areal befindet sich am Rand der rheinland-pfälzischen
Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler im Landkreis Ahrweiler.
Zunächst als römischer Gutshof (Villa Rustica) angelegt, vergrößert und
mehrfach umgebaut, wurde die Anlage gegen
259/60 n. Chr. planmäßig geräumt.
In der Spätantike erfuhr das Hauptgebäude eine Umnutzung zur Herberge
(Mansio), in die anschließend eine Eisenschmelze einzog.
Nach dem völligen Verfall und der Bedeckung des Geländes mit Schutt und
Geröll durch den direkt dahinterliegenden Silberberg entstand an diesem
Platz ein frühmittelalterlicher christlicher Friedhof. Die besondere
Bedeutung des ergrabenen und für die Öffentlichkeit konservierten
Hauptgebäudes
liegt in dem hervorragenden Erhaltungszustand vieler seltener Baudetails
und Wandmalereien. [Quelle: Wikipedia]
 1
Die Lage der "römischen Villa" von Ahrweiler 1
Die Lage der "römischen Villa" von Ahrweiler

Die Villa liegt direkt am "Fuße" des
Silberbergs in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler im Landkreis
Ahrweiler.
3D Visualisierung eines
römischen Korbsessels.
Beispiel einer
3D Bearbeitung. Es wird versucht am Original oder an einer antiken
Abbildung, die genaue Form des Objekts nachzubilden.
 2
Der Lageplan der Römervilla Ahrweiler 2
Der Lageplan der Römervilla Ahrweiler
Der Lageplan der Herberge (Mansio). Er ist die wichtigste Grundlage für die 3D
Visualisierung.

 3
Das Bearbeitungskonzept 3
Das Bearbeitungskonzept
Zur Zeit entstehen nur Einzelbilder der rekonstruierten
Räume. Falls alle Räume mit Inhalten ausgestattet sind, werden
Animationen erstellt. So lässt sich ein räumliches Bild von den
einzelnen Räumen gewinnen. In der dritten Phase werden lebende Personen
hinzugefügt. Erstmalig wird nach 2000 Jahren ein Lebensbild der Römer
in einer Mansio geschaffen.
 4
Die Römische Küche 4
Die Römische Küche
3D Küche
11 a der Herberge
(Mansia). Rekonstruiert von Archäologie
in Krefeld
|
3D Rekonstruktionen und Visualisierung
Raum 11a |
|

Bild 1 |

Bild 2 |

Bild 3 |
|

Bild 4 |

Bild 5 |

Bild 6 |
|

Bild 7 |
|
|
|
Bild 1 -7
Rekonstruktion der Küche
Die Römervilla hat eine Küche die
hervorragend gut erhalten ist. Archäologie in Krefeld hat diese Küche
mit Einrichtungsgegenständen ausgestattet. In der Küche wurde gekocht,
gebacken, geräuchert und eine Hypokausteranlage betrieben
(Fußbodenheißung). Einzigartig ist, dass der Backofen an ein
Abluftsystem angeschlossen wurde. Solche Nachweise sind selbst in Pompei
nur wenig bekannt. Eintauchen in eine längst vergangene Zeit ist ein
Abenteuer, das sich lohnt zu erschließen
Apicivs beschreibt ein Gericht, das uns sehr vertraut ist.
Ein Schweinekopf ähnlich wie wir heute ein Eisbein zubereiten. Im Bild
wird auf dieses Gericht eingegangen. (Bild
2)
Der Küchenjunge holt die Speisen aus der Küche und
serviert sie in den Speiseräumen der Villa. Die Küche liegt zentral und
konnte sehr schnell erreicht werden. (Bild
7) |
|
Quelle: Horst Fehr,
Römervilla, Führer durch die Ausgrabungen und Ausstellung am Silberberg
Bad Neuenahr-Ahrweiler |
|
|
 5
Der Vorratsraum 5
Der Vorratsraum
3D
Vorratsraum 11 der Herberge
(Mansia). Rekonstruiert von Archäologie
in Krefeld
3D Rekonstruktionen und Visualisierung Raum 11 |
|

Bild 1 |

Bild 2 |

Bild
3 |
|
Bild 1 -3
Rekonstruktion der Küche
Die Römervilla hatte im 3.-4.
Jahrhundert keinen Kellerraum um schnell verderbliche Waren kühl und vor
Licht geschützt zu lagern. Der Ausgräber H. Fehr ging von einer Lagerung der Waren
in einem Keller-Stollen des Silberbergs aus, wie es für die Weinlagerung
heute noch belegt ist. Der Raum hat keine Fenster und liegt der Küche
direkt gegenüber. Die Küche ist für die Zubereitung von Speisen
etwas zu klein dimensioniert. Daher ist der Raum gut geeignet konservierte Speisen zu
lagern bzw. Speisen aus den gelagerten Vorräten vorab zuzubereiten. Eine
Schweine-Schlachtung könnte auch hier stattgefunden haben
(Bild 1 u. 3). Anschließend wurden Teile des
Schweins in Tongefäße eingepökelt. Siehe Wandregal.
Der
Vorratsraum 11 der Küche. Hier wurden alle
Vorräte aufbewahrt. Das Konservieren spielte zu allen Zeiten eine sehr
wichtige Rolle.
|
|
|
 6
Die Kneipe (Caupona) 6
Die Kneipe (Caupona)
3D Caupona
(Kneipe). Rekonstruiert von Archäologie
in Krefeld
3D Rekonstruktionen und Visualisierung Raum 12 |
|

Bild 1 |

Bild 2 |

Bild 3 |
|
Bild 1 -3
Rekonstruktion der Kneipe
Die Römervilla hatte im
3.-4. Jahrhundert nach Aussage des Ausgräbers einen Gastraum mit
Ausschank. Vier in den Boden eingetiefte Standspuren von
Amphoren wurden festgestellt. Damit die Amphoren standsicher
waren, wurden sie mit Steinen verkeilt. Da es keinerlei
Nachweise einer gemauerten Theke gab, hat der Verf. eine
Holztheke mit Öffnungen rekonstruiert. So konnten die Amphoren
auch ausgewechselt werden. Die Rekonstruktion basiert auf
Originaltheken, die in Pompei noch vollkommen erhalten sind. Ein
Herd gehörte in einer Kneipe auch zur Ausstattung einer Caupona.
Auch hier in der Römervilla, gibt es so einen Herd. Er hat oben
noch eine runde Aussparung. In Pompei war in so einer Öffnung
eine Metallkonstruktion mit einem Ring eingelassen. Ein Kessel,
mit einem runden Boden, passte so perfekt auf einen Standring.
Der Herd war auch an ein Abluftsystem angeschlossen. Verrauchte
Räume wurden so vermieden.
Bild 1 u. 2 zeigt die Theke.
Hier werden Suppen und andere Gerichte, den Gästen in der
Mansio
gereicht. Im Hintergrund erkennen wir die Küche. In ihr wurden
weitere Speisen zubereitet. Übrigens, sah ein Käse genauso aus
wie auf dem
Bild 1
dargestellt. Er wurde aus der Negativform einer Käseform
abgebildet. |
|
|
 7
Der Porticus 7
Der Porticus
3D Porticus
(Wandelgang). Rekonstruiert von Archäologie
in Krefeld
3D Rekonstruktionen und Visualisierung des Porticus |
|

Bild 1 |

Bild 2 |

Bild 3 |
|

Bild 4 |

Bild 5 |

Bild 6 |
|
Bild 1 -6
Rekonstruktion des
Porticus
Vom Porticus der
Mansia (Herberge),
erschließen sich alle Zimmer der römischen Villa. Über eine
Haupttreppe, die nicht ganz symmetrisch zum Raum 12a angelegt
wurde, erreichen wir die Villa. In diesem Bereich wurde eine
Terrakotta-Maske eines Frauengesichts aus weißem Ton gefunden.
In einer Dissertation, geht der Verfasser davon aus, dass solche
Masken am Gebäude oder am Dach befestigt waren.
Eine Maske, wurde im Eingangsbereich
über der Tür von Raum 12a aufgehängt. Die Andere hing auf der gegenüberliegenden Seite der Villa, wo
wohl der Lieferanteneingang war. Die wichtigsten Zugänge der
Villa wollte man wohl mit aufgehängten Masken schützen.
Bild 4
zeigt einen römischen Schulunterricht. Die Szene wurde nach
einem bekannten Steinrelief, das man in Neumagen (Mosel) fand
nachgestellt (Bild
6).
Bild
5 zeigt das Lehrer-Schüler-Graffito aus dem
Obergeschoß über Raum10 oder2. Neckerei zwischen zwei Schülern:
1. Wer nicht gut gelernt hat, pflegt ein Schwätzer zu sein.
2. Die Peitsche des
grausamen Grat(t) us hat mich die Schrift gelehrt.
3. ?l
Bild 6 Neumagen, Schulrelief, Original im
Rheinischen Landesmuseum Trier. Nachbildung des Schulrelief.
|
|
Quelle: Horst Fehr,
Römervilla, Führer durch die Ausgrabungen und Ausstellung am Silberberg
Bad Neuenahr-Ahrweiler |
|
|
 8
Die Römervilla Ahrweiler (Außenanlage) 8
Die Römervilla Ahrweiler (Außenanlage)
3D Hypokaustum
(Fußbodenheizungsanlage). Rekonstruiert von Archäologie
in Krefeld
3D Rekonstruktionen und Visualisierung einer
Hypokaustheizung |
|

Bild 1
Ostansicht
|

Bild 2
Hypokausteranlage für Raum 3 |

Bild 3
Hypokausteranlage für Raum 3 |
|

Bild 4
Pflügender Bauer |

Bild 5
Weinanbau |

Bild 6
Thermen und Villa |
|
Bild 1 -3
Rekonstruktion der
Hypokausteranlage
Raum 3 der Villa hat eine
Fußbodenheizung.
Von außen wurde
geheizt. Sklaven gab es genug die solche Arbeiten verrichteten. Vermutlich wurde die
Heizungsanlage zu bestimmten Zeiten im Jahr durchgehend betrieben. In der Ansicht ist gut zu
erkennen, dass die Villa in den Hang gebaut wurde. Ein Bach
führt an der Mansia vorbei. Vielleicht zweigte er
oberhalb des Giesemer Bachs ab?
|
|
Bild
4 -6
Rekonstruktion der
Villa mit Thermen
Bild 4
zeigt einen Pflügenden Bauer. Ein Junge zieht die beiden Ochsen
vor sich her. Die Seile sind an einem Nasenringen der Ochsen
befestigt. Die Situation wird auf zwei römischen Bildquellen
dargestellt.
Bild 5
Die Römer haben nach Antiken Quellen mehr Weiswein getrunken.
Daher wurden in diesem Bild auch Trauben für Weiswein
dargestellt.
Bild 6 ist eine Gesamtansicht
der Villa. Links im Bild befinden sich die Thermen. Zwischen den
beiden Gebäuden wird das Wasser in einem Kanal angestaut. Mit
diesen technischen Trick kann ein Wasserschöpfrad betrieben
werden. Der Überlauf konnte als Wasserentnahmestelle genutzt
werden.
|
|
Quelle: Horst Fehr,
Römervilla, Führer durch die Ausgrabungen und Ausstellung am Silberberg
Bad Neuenahr-Ahrweiler |
|
|
 9
Die Thermen und Latrine der Mansio 9
Die Thermen und Latrine der Mansio
Rekonstruiert von Archäologie
in Krefeld
3D Rekonstruktionen und Visualisierung der Thermen und
anderer Objekte
|
|

Bild 1
Römische Latrine |

Bild 2
Römische Latrine |

Bild 3
Hypokausteranlage |
|

Bild 4
Caldarium |

Bild 5
Sudatorium. |

Bild 6
Tepidarium |
|

Bild 7
Frigarium |

Bild 8
Thermen.
1. Variante Dach |

Bild 9
Thermen mit Weg und Mauer.
2. Variante Dach
|
|

Bild 10
Thermen. Westansicht |

Bild 11
Römischer Würfelturm.
Nach Aussage des Finders, wurde dieser Spielturm in einer Therme
gefunden.
|

Bild 12
Römisches 3D Diatretglas.
Solche einzigartigen Gläser stammen aus der Spätantike. |
|
Die Thermen der Römervilla Ahrweiler
Wie lebhaft das Gedränge in einer
Therme gewesen ist, vermag wohl am
besten ein berühmter Brief zu schildern, den der römische
Philosoph und Staatsmann Seneca um
die Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. einem Freund schrieb.
Seneca hat sich während eines
Aufenthalts in Baiae nahe dem
heutigen Neapel über einer Thermenanlage einquartiert und
beklagt sich über den Lärm:
»Von allen Seiten umtönt mich wirrer Lärm, denn ich wohne gerade
über den Bädern. Stelle dir jetzt einmal alle Arten von Tönen
vor, die es einen bedauern lassen, dass man Ohren hat. Wenn die
Kräftigeren ihre Leibesübungen treiben und dabei ihre Hanteln
schwingen, wenn sie sich abarbeiten oder auch bloß so tun, dann
höre ich ihr Stöhnen und, sobald sie dem angehaltenen Atem
wieder seinen Lauf lassen, ihr Zischen und heftiges Keuchen.
Wenn ich aber auf einen Müßiggänger stoße, der sich bescheiden
nach plebejischer Manier salben lässt, so höre ich das Klatschen
der Hand auf den Schultern, das seinen Ton ändert, je nachdem
die Hand flach oder hohl aufschlägt. Kommt vollends noch ein
Ballspieler hinzu, der zählt, wie oft er den Ball abprallen
lässt, dann ist´s um mich geschehen.
Nimm nun noch einen Zankapfel hinzu und einen ertappten Dieb und
einen, der gern seine eigene Stimme im Bade ertönen hört; nimm
ferner noch hinzu die, die unter lautem Klatschen des
aufplätschernden Wassers ins Schwimmbassin springen! Außer
diesen, deren Laute doch wenigstens natürlich sind, denke dir
noch einen Haarausrupfer, der, um sich bemerkbarer zu machen,
wieder und wieder seine dünne, schrille Stimme hervorpresst und
erst schweigt, wenn er jemandem die Haare unter den Achseln
ausreißt und so einen anderen an seiner Statt schreien lässt.
Endlich die verschiedenen Ausrufe des Kuchenhändlers, der
Wurstverkäufer, der Zuckerplätzler und aller Kellner der
Kneipen, die sämtlich in ihrer eigentümlichen, durchdringenden
Tonweise ihre Waren anpreisen.
Latrine
Raum 48 beherbergt die Latrine der Mansio (Bild
1) . Hier konnten 8 Personen gleichzeitig ihren
"Geschäften" nachgehen. Unter dem Fußbrett fließt ständig
frisches Wasser, das die Latrine reinigt. Das Wasser kommt
oberhalb der linken Wand aus Bleirohren und spülte 2
Kanäle. Danach verließ das verschmutzte Wasser den Raum und
wurde in einem eigenen Schmutzwasser-Kanal weitergeführt. Die
Bürste wurde zum Reinigen der Öffnungen verwendet. Ein
Frischwasserbecken im Raum zum reinigen ist anderen Orts
nachgewiesen.
Hypokaustum der Thermen
Raum 33 beherbergt das Hypokaustum (Bild
3). Ein Hypokaustum oder Hypokauste (griech.:
ποκαίειν hypokaíein „darunter anzünden, darunter verbrennen“;
davon: πόκαυστος, - hypókaustos,- „von unten-) gebrannt /
beheizt (καυστός)“ ist eine Warmluftheizung
(Hypokaustenheizung), bei der ein massiver Körper mit warmer
Luft durchströmt wird, der aber im Vergleich zu einem Heizkörper
eine niedrigere Oberflächentemperatur hat. Als massive
Wärmeträger werden vor allem Fußböden oder Wände eingesetzt,
aber auch massive Sitzbänke oder andere Bauteile.
Die Konstruktion besteht aus einem Brennofen (lat. praefurnium) (Bild
3),
einem unter dem Fußboden liegenden Heizraum (lat. hypocaustum)
und Abzügen für die heiße Luft und die Abgase. Der Brennofen
liegt in einem separaten Raum. Der Heizraum bestand aus im
Abstand von etwa 30 bis 40 cm aufgeschichteten, etwa 30 bis 60
cm hohen Ziegeltürmchen aus quadratischen oder runden Platten,
die zunächst eine größere Deckplatte trugen. Auf dieser Platte
lag die große Tragplatte, auf der der Estrich aufgebracht war.
Die gesamte Konstruktion des Fußbodens war etwa 10 bis 12 cm
dick und benötigte mindestens mehrere Stunden, wenn nicht ein
oder zwei Tage bis zur völligen Durchwärmung. Von dem unter dem
beheizten Raum gelegenen Heizraum strömte die heiße Luft in die
Wandkanäle (tubuli), die auf diese Weise auch die Wände
beheizten. Erst dann trat die Luft ins Freie aus. Der Römer
Gaius Sergius Orata (um 90 v. Chr.) gilt als Erfinder in der
Antike.
Hypokausten hatten einen ausgesprochen hohen Energieverbrauch,
so dass Archäologen heute davon ausgehen, dass während der
späteren römischen Besiedlung im Umfeld von Siedlungen die
Wälder wegen ihrer Verwendung als Brennstoff abgeholzt wurden.
Quelle:
WIKIPEDIA
Caldarium
Im Raum 34 (Bild
4) befindet sich das Heißbad (caldarium). Hier wurde
der Raum durch die Hypokausteranlage mit beheiztem Fußboden,
Wand und Wanne auf eine Temperatur von ca. 40 bis 50 Grad C
gebracht. Im Raum 34 gab es einen Plattenbelag aus
Schieferplatten und geschliffenen gelbweißlichen
Kalksteinplatten. Dies wurden bei der Rekonstruktion des Bodens
so genau wie möglich wiedergegeben. Unterhalb des Fensters
strömte das heiße Wasser in die halbbogenförmige Badewanne. Das
Wasser wurde in einem Bleibehälter vom Nachbarraum erhitzt.
Sudatorium
Ein Sudatorium (Bild
5) (vom lat. sudare: schwitzen) bzw.
concamerata sudatio (nach Vitruv) bezeichnete ein
Dampfschwitzbad in antiken Thermen. Es ist vergleichbar mit
heutigen Saunen. Auch heute noch wird der Begriff für Dampfbäder
in römisch-irischen Bädern verwendet. Eine Hypocaustanlage im
Fußboden beheizte die Luft. Die Steine wurden von einem Perfusor
(Dampfaufgießer) befeuchtet, der zumeist ein Sklave war. Der
Dampf verließ den Raum durch eine Öffnung im Dach. Da der
Fußboden sehr heiß wurde, mussten, wie Funde belegen,
Holzpantinen getragen werden. Der Raum 32 beinhaltet zusätzlich
ein Labrum, ein Wasserspringbrunnen. Ein Randstück des Labrums
wurde bei Ausgrabungen gefunden.
Frigarium
Im Raum 31/25 (Bild
7) befindet sich das Kaltbad (frigarium). Dieser Raum
hat keine Wand- und Fußbodenheizung. Im Raum 25 gab es einen Plattenbelag aus
Schieferplatten und geschliffenen gelbweißlichen
Kalksteinplatten. Dies wurden bei der Rekonstruktion des Bodens
so genau wie möglich wiedergegeben. Im Raum 31 unterhalb des Fensters
strömte das kalte Wasser in die rechteckige Badewanne die
piscina genannt wird. Im Raum 25 wurden auch kalte Aufgüsse
sowie Massagen auf Klinen durch den Bader durchgeführt.
Tepidarium
Ein Tepidarium (Bild
6) (lat.
tepidus „lauwarm“) ist ein Wärmeraum, in dem
Bänke und Liegen, aber auch Wände und Boden beheizt
sind. Die Luft ist trocken, die Lufttemperatur
beträgt üblicherweise etwa 38 bis 40 °C. Der
Besuch erfolgt leicht bekleidet, z. B. mit
Bademantel oder Kutte.
Wie der Name bereits andeutet, ist das Konzept
römischen Ursprungs und war Teil der Badekultur im
Römischen Reich. Im Gegensatz zur damaligen Praxis
wird heute eine etwas höhere Temperatur verwendet.
Durch die ein wenig über der Körpertemperatur
liegende Raumtemperatur wird die Durchblutung des
Körpergewebes verbessert; dies erleichtert die
Entspannung, außerdem kann man auf diese Weise
versuchen, die Heilung von Gefäßerkrankungen,
leichten Infektionen (z. B. Erkältung und Husten
ohne Fieber), Rheuma und Stoffwechselkrankheiten zu
begünstigen.
Quelle:
WIKIPEDIA
Thermen-Außenansichten
Außenansicht (Bild
8, 9 u. 10). An den Thermen führte ein Weg vorbei. Er
erschloss das Tal des Giesemer Bachs. Der Weg stieß auf den
Hauptweg der im Ahrtal alle wichtigen Siedlungen mit einander
verband. Abgebildet ist ein Weinwagen. Wein wurde hier
vermutlich an den unteren Hängen angebaut. Nachweise
terrassenförmiger Anlagen fehlen zur Zeit. Die Thermen wurden
beheizt. Sogenannte Tubuli befanden sich im Innenraum der
Wänden. Warme erhitzte Luft durchströmte den Boden und die
Wände. An der Außenwand entwich der Rauch.
Quelle:
WIKIPEDIA |
|
Quelle: Horst Fehr,
Römervilla, Führer durch die Ausgrabungen und Ausstellung am Silberberg
Bad Neuenahr-Ahrweiler |
 10
Die Wasserhebeanlage 10
Die Wasserhebeanlage
Rekonstruiert von Archäologie
in Krefeld
3D Rekonstruktionen und Visualisierung eines
Wasserschöpfrades
|
|

Bild 1
Thermen -Gesamtanlage
|

Bild 2
Themen mit einem Wasserschöpfrad. Der Antrieb erfolgt über einen Göpel.
|

Bild 3
Rekonstruktion Staukanal. Der archäologische Befund.
|
|
|
Das Wasserschöpfrad der Thermen
Als
Vorlage diente das Wasserschöpfrad vom Rio Pinto
(Bild
1 u.2). Es
entwässerte die Silberminenabbaugruben. Die schmale
Ausführung des Rades passt perfekt in den Staukanal
der Römervilla Ahrweiler, der archäologisch
nachgewiesen vorliegt
(Bild 3).
Ein gemauerter Frischwasserkanal leitete das Wasser
des Giesemer Bachs direkt in den Staukanal. Mit
einem Flachschieber wurde dass Wasser angestaut. Ein
Überlauf sorge dafür, das das Wasser nicht
unkontrolliert austrat. Der Überlauf versorgte die
Mansia mit frischem Quellwasser. Die
Wasserhebeanlage wurde mit einem Esel betrieben. Man
spricht von einem sogenannten Göpel. Die Berechnung
der Förderleistung steht noch aus. Archäologie in
Krefeld hat als erster die Erkenntnisse der
Wasserversorgungsanlage der Römervilla Ahrweiler
bekannt gemacht. Die Technik der Antike ist in ihrer
Bautechnik längst nicht vollkommen erschlossen.
Experimentelle
Archäologie lautet das Stichwort.
Der folgende Stream zeigt ein römisches
Wasserschöpfrad fotorealistisch dargestellt.
Videofilm


Film: Dipl.-Ing.
Detlef Stender, Wasserschöpfrad
 11
VR (virtual reality) der Römervilla 11
VR (virtual reality) der Römervilla
3D Rekonstruktionen und Visualisierung nach
dem Stand der Technik.
VR ist
ein Ziel, das sich die Entwickler weltweit gesetzt
haben
(Bild
1). Nun
scheint man dem Ziel deutlich näher gekommen zu
sein. Oculus Rift
hat eine Brille entwickelt womit man 3D auf eine nie
gekannte Weise erleben kann. Archäologie in Krefeld
möchte dieses Instrument für die Rekonstruktion der
Römervilla mit all den Einrichtungsgegenständen
nutzen. Heute entstand das erste Panoramabild der
Vorratskammer. Diese lag der Küche gegenüber.
Panorama 3D funktioniert hervorragend. Das Panoramabild
ist im Original 8 Mb groß. Es wurde hier stark
verkleinert wiedergegeben.

Bild 1
Panoramabild des Caldarium.
Dieses Bild wird mit
einem App in ein Handy geladen. Die App verwandelt das Bild und
teilt es in 2 Sehhälten auf. Das Bild ist entstanden aus dem
Programm Thea Render. Diese Software rendert das Bild zu einem
Panoramabild. 6 Rechner arbeiten zusammen. Das Ergebnis ist nach 14
Stunden fertig.
 12
Raum 6 12
Raum 6
Rekonstruiert von Archäologie
in Krefeld
3D Rekonstruktionen und Visualisierung der Räume
|
|

Bild 1
Raum 6 |

Bild 2
Raum 6 |
Bild 3
Raum 6 |

|
|
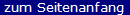 |
|















































