| |
Schlösser und Beschläge der Römerzeit
Ein Beitrag zur Technikgeschichte
der Antike
von Detlef Stender
 it
dem römischen Reich erreichte die Gesellschaft der alten Hochkulturen den Höhepunkt aber auch den Endpunkt ihrer Verwirklichungsmöglichkeit. Die Expansion Roms vom
provinziellen Stadtstaat zu einem an die Grenzen der bekannten Welt stoßenden Imperiums war von außerordentlichen Ausweitung des Handels und des Gewerbes, aber auch von
wachsenden Konflikten und dem Bewusstsein des gefährdetseins begleitet. Das daraus resultierende gesteigerte Sicherheitsbedürfnis kommt in der beispiellosen Vielfalt und
Massenhaftigkeit der archäologischen Schloss- und Schlüsselfunde deutlich zum Ausdruck. (Abb. 1) it
dem römischen Reich erreichte die Gesellschaft der alten Hochkulturen den Höhepunkt aber auch den Endpunkt ihrer Verwirklichungsmöglichkeit. Die Expansion Roms vom
provinziellen Stadtstaat zu einem an die Grenzen der bekannten Welt stoßenden Imperiums war von außerordentlichen Ausweitung des Handels und des Gewerbes, aber auch von
wachsenden Konflikten und dem Bewusstsein des gefährdetseins begleitet. Das daraus resultierende gesteigerte Sicherheitsbedürfnis kommt in der beispiellosen Vielfalt und
Massenhaftigkeit der archäologischen Schloss- und Schlüsselfunde deutlich zum Ausdruck. (Abb. 1)
Auch wenn in diesen Funden viele der aus den älteren Kulturen bekannten Riegel- und Schlosskonstruktionen noch gegenwärtig sind, belegen
sie eine geradezu sprunghafte Weiterentwicklung der Schließtechnik: Die Mechanik des hölzernen Fallriegelschlosses (bereits bei den Ägypter bekannt) wurde auf eine
Metallkonstruktion übertragen und die
Sperrwirkung der Fallstifte (Abb. 1/Pos. B)
durch eine Blattfeder verbessert. Es entstand ein sehr präzise arbeitendes Schloss von relativ geringen Ausmaßen und hohem Sicherheitswert, das
in der Kombination mit einer Überfalle oder einem Grendelriegel für den Römischen Bürger zum Universalschloss für
Türen, Möbel und Kästchen wurde. Zur Sicherung
besonders schwerer Türen diente ein Schloss mit Zahnstangenriegel. Als Verschluss für alle beweglichen Güter setzte sich das ortsunabhängige Vorhängeschloss auf
Sperrfederbasis endgültig durch. Die bedeutendste konstruktive Neuerung der römischen Schmiede aber war die Entwicklung des Drehschlüsselschlosses aus dem Sperrfedersystem
(Abb. 2/Pos. 6).
 ei Möbeltüren, konnten Bänder aus Eisen, Bronze oder Bein an die Stelle des Zapfens, der "klassischen" Form der Türhalterung treten.
Figürlich gestaltete Ziehgriffe aus Bronze und Ziernägel unterschiedlichster Form und Größe aus dem gleichen Material prägten das "Gesicht" der Tür. ei Möbeltüren, konnten Bänder aus Eisen, Bronze oder Bein an die Stelle des Zapfens, der "klassischen" Form der Türhalterung treten.
Figürlich gestaltete Ziehgriffe aus Bronze und Ziernägel unterschiedlichster Form und Größe aus dem gleichen Material prägten das "Gesicht" der Tür.
 ömische Schlösser müssen sehr
verbreitet gewesen sein. Davon gelangen besonders die Schlüsselfunde
und nicht die Schlosskästen sehr häufig in den europäischen Handel für Kulturgut, weil sie häufig aus Bronze sind und daher für Sammler ein interessantes Objekt darstellen. So werden immer wieder viele
dieser Schlüsselfunde auf römischen Siedlungsplätzen gemacht. Vermutlich gefunden durch das gezielte Absuchen der nach profitstrebenden Sondengänger. ömische Schlösser müssen sehr
verbreitet gewesen sein. Davon gelangen besonders die Schlüsselfunde
und nicht die Schlosskästen sehr häufig in den europäischen Handel für Kulturgut, weil sie häufig aus Bronze sind und daher für Sammler ein interessantes Objekt darstellen. So werden immer wieder viele
dieser Schlüsselfunde auf römischen Siedlungsplätzen gemacht. Vermutlich gefunden durch das gezielte Absuchen der nach profitstrebenden Sondengänger.
 m Gräberfeld von Krefeld-Gellep, finden sich eine ganze Reihe dieser Schlösser in Gräbern. Im oben
dargestellten Fall handelt es sich um ein Drehschlüsselschloss m Gräberfeld von Krefeld-Gellep, finden sich eine ganze Reihe dieser Schlösser in Gräbern. Im oben
dargestellten Fall handelt es sich um ein Drehschlüsselschloss
(Abb. 3).
Das
Kästchen, wurde bei den jährlich stattgefundenen Ausgrabungen im Gräberfeld von Gellep gefunden, geborgen und anschließend restauriert. Die Metallteile aus Eisen
sind leider zum größten Teil der Korrosion zum Opfer gefallen. Die beiden Scharniere wurden heruntergeklappt und fügten sich in den Schlosskasten ein, wobei der
Verriegelungsmechanismus im innern des Schlosses stattfand. Vermutlich wurden nach der Drehung des Schlüssels zwei Schieberiegel verschoben die zum Verschluss der Scharniere führten.
Ein angewinkeltes stark korrodiertes Eisenteil, befindet sich in der Vitrine des Museums Burg Linn. Der mechanische Zusammenhang muss noch rekonstruiert werden.
Das spätrömische Frauengrab
aus
Dorweiler
Beschreibung eines Drehschlüsselschlosses ohne Sperrfedersystem
 in besonders interessanter Fund eines Schlosses wurde im März 1943 in
Dorweiler das in der Ebene zwischen der in besonders interessanter Fund eines Schlosses wurde im März 1943 in
Dorweiler das in der Ebene zwischen der 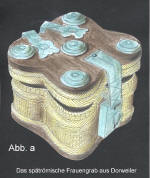 Erft und dem Neffelbach im Kreis Euskirchen liegt gemacht. Dort fand ein Landwirt im Garten bei der Ausschachtung für einen
Unterstand zwei spätrömische Steinsärge. In Ihnen wurden zwei aus Korbgeflecht und mit Schlössern versehene Körbchen gefunden.
(Abb. a) Erft und dem Neffelbach im Kreis Euskirchen liegt gemacht. Dort fand ein Landwirt im Garten bei der Ausschachtung für einen
Unterstand zwei spätrömische Steinsärge. In Ihnen wurden zwei aus Korbgeflecht und mit Schlössern versehene Körbchen gefunden.
(Abb. a)
Die Erhaltungsbedingungen für organische
Stoffe, die in der Nähe von Bronze liegen, sind auf Grund der keimtötenden Wirkung von Patina recht günstig. Im vorliegenden Fall konnte auf Basis der guten
Erhaltungsbedingungen, das Flechtwerk des Körbchen rekonstruieren werden.

3D Korb. Unmaßstäblich.
Beschreibung des Körbchens
mit
Schloss- und Beschläge:
 as Schloss besteht aus einem rechteckigen, kastenförmigen Schlossblech,
4,1 x 3,2 x 0,8 cm groß, auf der Schauseite mit konzentrischen Rillen verziert, unten das Schlüsselloch, oben der Schlitz zur Aufnahme des Überwurfes. Zwei angelötete
0,8 breite Bronzebänder verklammern das Schloss mit dem Körbchen. Der bewegliche Schlossriegel besteht aus Eisen, die Führung aus Holz, deren Rückseite der Krümmung der
Korbwand angepasst ist. Den Mechanismus des Schlosses veranschaulicht (Abb. b) as Schloss besteht aus einem rechteckigen, kastenförmigen Schlossblech,
4,1 x 3,2 x 0,8 cm groß, auf der Schauseite mit konzentrischen Rillen verziert, unten das Schlüsselloch, oben der Schlitz zur Aufnahme des Überwurfes. Zwei angelötete
0,8 breite Bronzebänder verklammern das Schloss mit dem Körbchen. Der bewegliche Schlossriegel besteht aus Eisen, die Führung aus Holz, deren Rückseite der Krümmung der
Korbwand angepasst ist. Den Mechanismus des Schlosses veranschaulicht (Abb. b)
 Der zwangsläufigen Führung des Riegels dienen der Schlitz und die Anschlagkanten in dem
Holzklötzchen. Das zierliche Ringschlüsselchen besteht aus Bronze. (Man nennt diese Schlüssel so, weil sie am Finger übergestülpt getragen wurden.) Es konnte nur
vom geschlossenen Körbchen abgezogen werden. Auf den Bronzebeschlägen des Körbchens haftete zum Teil durch Kontakt mit Bronze gut konservierte Reste von einfachem Gewebe.
Innen im Körbchen, unter dem Schloss und den Scharniersplinten waren geringe Lederreste erhalten, wahrscheinlich war das Körbchen innen mit Leder ausgekleidet. Der zwangsläufigen Führung des Riegels dienen der Schlitz und die Anschlagkanten in dem
Holzklötzchen. Das zierliche Ringschlüsselchen besteht aus Bronze. (Man nennt diese Schlüssel so, weil sie am Finger übergestülpt getragen wurden.) Es konnte nur
vom geschlossenen Körbchen abgezogen werden. Auf den Bronzebeschlägen des Körbchens haftete zum Teil durch Kontakt mit Bronze gut konservierte Reste von einfachem Gewebe.
Innen im Körbchen, unter dem Schloss und den Scharniersplinten waren geringe Lederreste erhalten, wahrscheinlich war das Körbchen innen mit Leder ausgekleidet.
Von dem zweiten Körbchen war nur mehr der Deckel mit anhängendem Schloss einigermaßen erhalten Durchmesser 16,5 - 17,0 cm. Das Flechtwerk war dem anderen Körbchen
ähnlich, wie die erhaltenen Reste zeigen. Der Deckel bestand aus einem 0,6 cm dicken Holzbrett, das oben ganz mit Leder überzogen war.
Die Scharnierbänder aus papierdünnen Bronzeblech enden oben in einer vierpassähnlichen Scheibe, sie sind mit Linienkreuzen aus Doppelriefen verziert, oben und seitlich am
Deckel einmal festgenietet, unten am Einhängeloch für den Splint umgebördelt, drehbar am Korb mit je einem Splint befestigt. Ein offenbar geflicktes Band ist aus zwei
Teilen zusammengenietet. Der Überwurf, aufgebogen, ist auf dem Deckel mit einer Splintöse beweglich befestigt. Drei feine, doppelte Längsriefen auf der Oberseite, zwei
liegende Kreuze aus Doppellinien vorne und Randkerben am unteren Ende zieren seine Oberfläche. Auf der Unterseite war die Öse angelötet, die in das Schloss eingriff. Fünf
Buckelscheiben aus dünnen Bronzeblech, mit konzentrischen Doppelrillen verziert, waren durch Eisenstifte auf dem Deckel festgenagelt, vier außen in den Pässen, einer in
der Mitte. Auch auf diesen Metallteilen haften Reste von einfachem Gewebe.
Folgt man dem Verfasser der Beschreibung weiter, so finden sich keine Details zum
Schlossinnern. Die Fingerringschlüssel dagegen zeigen einen Bart mit unterschiedlichen Bartformen. Zu jedem Schloss gehörte der passende Schlüssel. Die Funktionsweise
bleibt weiter ungeklärt, da bestimmte Teile des Schlosses durch korrosive Prozesse sich nicht erhalten haben. Der Verf. versucht durch Ansicht der Originalfunde eine neue
Deutung der Funktion zu ermitteln. Die Untersuchungen laufen zur Zeit.
Ein spätrömisches
Vorhängeschloss aus einem
Verwahrfund aus dem Königsforst
Beschreibung eines Drehschlüsselschlosses mit Sperrfedersystem
 en hohen Technologiestand römischer Verschlusssysteme stellt das im Königsforst gefundene Vorhängeschloss dar.
Dieser Schlosstyp wurde im besonders als bewegliches Vorhänge- oder auch Vorlegeschloss verwendet. en hohen Technologiestand römischer Verschlusssysteme stellt das im Königsforst gefundene Vorhängeschloss dar.
Dieser Schlosstyp wurde im besonders als bewegliches Vorhänge- oder auch Vorlegeschloss verwendet.
Eines dieser Schlösser wurde in einem Massengrab
von
 Zivilisten im Mithräum von Gelduba gefunden (Es handelte sich vorwiegend um eine größere Gruppe erschlagener Frauen, Kinder und alter Leute). Am Fuß eines der Toten
fand sich eine eiserne Kette mit einem dosenförmigen Schloss und könnte ein Hinweis auf den Gebrauch dieser Schlösser auch bei Gefangenen sein (Abb.
c). Dieses Schloss zeigt sehr viel Ähnlichkeit mit dem hier näher beschriebenen Schlosstyp. Es liegt
daher die Vermutung nahe, dass diese Schlösser serienmäßig vielleicht industriell also somit in großen Stückzahlen hergestellt wurden. Zivilisten im Mithräum von Gelduba gefunden (Es handelte sich vorwiegend um eine größere Gruppe erschlagener Frauen, Kinder und alter Leute). Am Fuß eines der Toten
fand sich eine eiserne Kette mit einem dosenförmigen Schloss und könnte ein Hinweis auf den Gebrauch dieser Schlösser auch bei Gefangenen sein (Abb.
c). Dieses Schloss zeigt sehr viel Ähnlichkeit mit dem hier näher beschriebenen Schlosstyp. Es liegt
daher die Vermutung nahe, dass diese Schlösser serienmäßig vielleicht industriell also somit in großen Stückzahlen hergestellt wurden.
An dem dosenförmigen Vorhängeschloss wurde eine Eisenkette angeschmiedet. Das andere Ende besitzt
eine spezielle konstruktive Form um im Schloss einzurasten. Diese Kette kann aus gleichmäßigen langovalen Gliedern bestehen oder sich aus abwechselnder Folge von ovalen
und achtförmigen Gliedern zusammensetzen.
Die im Königsforster aufgefundene Kette besteht aus einzelnen Kettengliederabschnitten. Zusammengelegt ergibt sich eine Länge von etwa 75 cm.
Beschreibung des
dosenförmigen Schlosses mit
Sperrfedersystem:
 rotz des schlechten Erhaltungszustandes und der fehlenden Gehäuseteile sind
alle Funktionselemente und Zusammenhänge deutlich erkennbar. Insgesamt haben sich für die Rekonstruktion erhalten: Der Boden mit etwa einem Drittel der angelöteten
Seitenwandung; der überwiegende Teil der restlichen Seitenwandung mit zwei ansitzenden Fragmenten der Deckplatte, darauf dicht am Rande fast diametral angeordnet zwei
mächtige Nietköpfe. Das eiserne Gehäuse und die anderen Konstruktionselemente im Innern sind in unterschiedlichem Maße korrodiert. Am stärksten angegriffen sind die
Nietstifte und andere Kleinteile. Wie es auch bei anderen Dosenschlössern üblich ist, wird das Schloss mit einem schmalen Messingband mittig umschlossen. Das Schloss
misst soweit rekonstruierbar, 10,2 cm im Durchmesser und ist ohne Nietköpfe 3,8 cm, mit diesen 4,6 cm hoch. Die Bauteile der Innenkonstruktion sind
rechtwinklig zu den Flachseiten ausgerichtet und, soweit erforderlich, an diese angelötet. Über die chemische Zusammensetzung der Lötverbindung kann zur Zeit keine
Angaben gemacht werden. Das kann nur durch ein metallografisches Untersuchungsverfahren geklärt werden. Das Gehäuse baut sich jeweils aus zwei runden Eisenscheiben, je
ca. 0,2 - 0,3 cm stark, auf der Vorder- und Rückseite auf. Als Abstandhalter fungieren die Drehhülse, die Zuhaltung mit ihrer gabelförmigen Verzweigung an einem Ende und
das Widerlager der Blattfeder. Den notwendigen Druck von Außen, um den halt Zusammenhalt zu gewährleisten, erzeugen mindestens zwei Niete. Sie enden an der Rückseite des
Schlosses zwischen der äußeren und inneren Platte, sind also von dieser Seite nicht sichtbar. Ein dritter Niet kann zusätzlich Halt gegeben haben, ist aber aufgrund des
Erhaltungszustandes nicht mehr fassbar. rotz des schlechten Erhaltungszustandes und der fehlenden Gehäuseteile sind
alle Funktionselemente und Zusammenhänge deutlich erkennbar. Insgesamt haben sich für die Rekonstruktion erhalten: Der Boden mit etwa einem Drittel der angelöteten
Seitenwandung; der überwiegende Teil der restlichen Seitenwandung mit zwei ansitzenden Fragmenten der Deckplatte, darauf dicht am Rande fast diametral angeordnet zwei
mächtige Nietköpfe. Das eiserne Gehäuse und die anderen Konstruktionselemente im Innern sind in unterschiedlichem Maße korrodiert. Am stärksten angegriffen sind die
Nietstifte und andere Kleinteile. Wie es auch bei anderen Dosenschlössern üblich ist, wird das Schloss mit einem schmalen Messingband mittig umschlossen. Das Schloss
misst soweit rekonstruierbar, 10,2 cm im Durchmesser und ist ohne Nietköpfe 3,8 cm, mit diesen 4,6 cm hoch. Die Bauteile der Innenkonstruktion sind
rechtwinklig zu den Flachseiten ausgerichtet und, soweit erforderlich, an diese angelötet. Über die chemische Zusammensetzung der Lötverbindung kann zur Zeit keine
Angaben gemacht werden. Das kann nur durch ein metallografisches Untersuchungsverfahren geklärt werden. Das Gehäuse baut sich jeweils aus zwei runden Eisenscheiben, je
ca. 0,2 - 0,3 cm stark, auf der Vorder- und Rückseite auf. Als Abstandhalter fungieren die Drehhülse, die Zuhaltung mit ihrer gabelförmigen Verzweigung an einem Ende und
das Widerlager der Blattfeder. Den notwendigen Druck von Außen, um den halt Zusammenhalt zu gewährleisten, erzeugen mindestens zwei Niete. Sie enden an der Rückseite des
Schlosses zwischen der äußeren und inneren Platte, sind also von dieser Seite nicht sichtbar. Ein dritter Niet kann zusätzlich Halt gegeben haben, ist aber aufgrund des
Erhaltungszustandes nicht mehr fassbar.
|
|
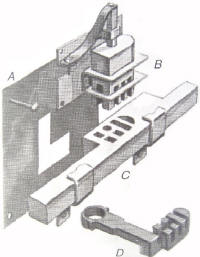 |
|
Der Schlüssel
Vom Originalschlüssel
zum
Schloss
 m vorliegenden Fall wird der Versuch unternommen mit Hilfe eines Schlüssels
(Abb. 10) das dazugehörende Schloss zu rekonstruieren. Römische Schlösser kann man in Gruppen aufteilen. Bisher sind mir 2 Grundtypen bekannt. Eine Gruppe
gehört den sogenannten Fallriegelschlössern an. Die andere Gruppe werden als Drehschlüsselschlösser mit Sperrfedersystem
bezeichnet. m vorliegenden Fall wird der Versuch unternommen mit Hilfe eines Schlüssels
(Abb. 10) das dazugehörende Schloss zu rekonstruieren. Römische Schlösser kann man in Gruppen aufteilen. Bisher sind mir 2 Grundtypen bekannt. Eine Gruppe
gehört den sogenannten Fallriegelschlössern an. Die andere Gruppe werden als Drehschlüsselschlösser mit Sperrfedersystem
bezeichnet.
Im Schloss- und Beschlägemuseum in Velbert können beide Schlösser in ihrer Funktionalität betrachtet und ausprobiert werden.
Der Besuch des Museums ist für Eltern mit Kindern aus pädagogischer Sicht daher besonders empfehlenswert.
Auf den folgenden Bildern sehen Sie den ersten
Entwurf des Schlüssels.
Auf dem nächsten Bild ist der Schieberiegel mit Schlüssel dargestellt
(Abb. 12). Der Verfasser bedankt sich besonders bei
Herrn Achim Raasch, der sich mit großer Leidenschaft für das Gelingen der zeichnerischen, und wissenschaftlichen Rekonstruktion einsetzt.
Der Weg
zur
Konstruktion
von Achim Raasch
 ür
den römischen Schlüssel (Abb. 10) wird angenommen, dass er vor ca. 2000 Jahren für ein Fallriegelschloss ür
den römischen Schlüssel (Abb. 10) wird angenommen, dass er vor ca. 2000 Jahren für ein Fallriegelschloss
(Abb. 1)
in Verbindung mit einem Grendelriegel gefertigt wurde. Die gesamte digitale Rekonstruktion basiert auf dieser Annahme.
Zunächst
wurde der Originalschlüssel exakt vermessen und aus den messtechnischen Daten eine dreidimensionale digitale Zeichnung erstellt.
(Abb. 11)
Für
die Darstellung des Schieberiegels, in den der Schlüssel einrasten musste, standen einige Fotos von Originalfunden zur Verfügung die miteinander verglichen wurden. Auf
Grund der erkennbaren einheitlichen Charakteristik auf den Abbildungen, ließ sich dann ein recht authentisches Modell, passend zur Zähnung des
Schlüssels, erzeugen.
(Abb. 13)
Die Rekonstruktion weiterer Details wie Arretierzylinder, Druckfeder, Türblech mit hakenförmigen Schlüsselloch, der gesamte Halterungsapparat und des Grendelriegels
gestaltete sich danach aber etwas schwieriger, da keinerlei originale Anschauungsobjekte zur Verfügung standen. Hierbei orientierten wir uns an Abbildungen dieser
Schlossart sowie 2 Schlossnachbauten (Abb. 8 u. 9) und ergänzten fehlende Informationen durch das logische Nachvollziehen der
mechanischen Funktion dieser Verrieglung.
Im Endergebnis erhielten wir dann eine plausible dreidimensionale Abbildung des Fallriegelschlosses mit Grendelriegel
(Abb. 14 - 17), der zu dem Originalschlüssel gepasst haben könnte.
Zur besseren Veranschaulichung ist es in absehbarer Zeit angedacht die Funktionsweise des Schlosses in einer 3D-Animation darzustellen, es also virtuell in Aktion zu sehen.
|
|