|
Eisenzeit
Vitrine 3-7
Die Niederrheinische Bevölkerung nach römischen
Berichten
 ber die Stämme des Niederrheins
unterrichtet uns als erster der römische Feldherr G. I. Caesar, der Gallien (Frankreich und das angrenzende Land bis
zum Rhein) in den Jahren 58 - 51 v. Chr.
eroberte und als neue Provinz dem Römischen Reiche einverleibte. ber die Stämme des Niederrheins
unterrichtet uns als erster der römische Feldherr G. I. Caesar, der Gallien (Frankreich und das angrenzende Land bis
zum Rhein) in den Jahren 58 - 51 v. Chr.
eroberte und als neue Provinz dem Römischen Reiche einverleibte.
Nach Caesar
wurde der Niederrhein von germanischen Stämmen bewohnt. Und zwar von Stämmen, die
nicht erst zuvor hier eingewandert waren, sondern die schon seit
langer Zeit hier siedelten. Allerdings berichtet er von zwei weiteren
Stämmen, den Usipetern
und
Tenkterern,
die erst im Jahre 56 nach längerer
Wanderschaft aus dem Inneren Germaniens
an den Niederrhein kamen.
Im Westen grenzte das Gebiet der
Niederrheingermanen an das der Belger,
die Caesar als eigenes Volk
neben Kelten und Germanen stellte, und im Süden an das der Kelten,
bzw. Gallier im engeren Sinne.
Das von den Niederrheingermanen eingenommene Siedlungsgebiet lässt
sich ungefähr mit dem Verbreitungsgebiet der archäologisch
festgestellten Niederrheinischen Grabhügelkultur zur Deckung bringen. Daraus ergibt sich,
dass der Niederrhein nicht erst durch eine Einwanderung
germanisch wurde, sondern von Anfang an, seit der Herausbildung des
Volkes, zum Siedlungsgebiet der Germanen gehört hat.
Tracht und Kleidung
der Eisenzeit
Raum 3 /
Vitrine 7
/ Abb.
8
Der Mann
 ekonstruiert nach Moorfunden und Darstellung gefangener auf der
Markussäule in Rom. ekonstruiert nach Moorfunden und Darstellung gefangener auf der
Markussäule in Rom.
Der Mann trug einen hemdartigen Kittel und eine Hose mit angenähten
Füßlingen. Darüber einen Mantel, der an der Schulter durch eine Nadel (in
der jüngeren Eisenzeit durch eine Fibel / Spange) zusammengehalten wurde.
Raum 3 /
Vitrine 7
/ Abb.
8
Die Frau
Die Frau trug ebenfalls einen hemdartigen Kittel. Der Kittel konnte
bodenlang sein oder mit einem Rock kombiniert werden. Das Oberkleid war
nicht zugeschnitten wie der Mantel des Mannes. Es wurde um den Körper
drapiert und meist unten hochgebunden. Auf der Schulter hielten es eine
oder zwei Nadeln (später Fibeln)
zusammen. Der Gürtel wurde gelegentlich mit einem eisernen Doppelhaken
geschlossen.
Häufig getragene Schmuckstücke bildeten Halsringe oder Ketten, Armringe
und auch Ohrringe.
Im Detail unterlag die Tracht jedoch - auch innerhalb der
Niederrheinischen Grabhügelkultur -
regionale Unterschiede. Beim derzeitigen Stand der Forschung können diese
allerdings noch nicht deutlich herausgearbeitet werden.

|
|
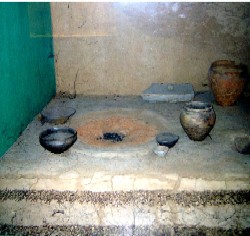
|
|
Beschreibung der Funde
Raum 1
/ Vitrine
3 /
Abb.
2
Eisenzeitliche Herdstelle
Rekonstruktion
 ie Herdstelle ist die wichtigste
Einrichtung der Küche, Sie diente nicht nur zum Kochen, sondern bildete
auch die einzige Heizeinrichtung des Hauses, Backöfen lagen nur in
Ausnahmefällen innerhalb des Gebäudes (siehe
Hausmodell aus Vreden im 2. Raum). ie Herdstelle ist die wichtigste
Einrichtung der Küche, Sie diente nicht nur zum Kochen, sondern bildete
auch die einzige Heizeinrichtung des Hauses, Backöfen lagen nur in
Ausnahmefällen innerhalb des Gebäudes (siehe
Hausmodell aus Vreden im 2. Raum).
Der Herd liegt durchweg als freie umgehbare Feuerstelle im Raum.
Gemeinschaftsmühlen waren in der Eisenzeit
noch nicht gebräuchlich, so dass jede Hausfrau ihr Mehl selber mit Hilfe
eines Mahlsteins herstellen musste, hier handelt es sich um einen
eiszeitlichen Geschiebeblock (gefunden in Bösinghoven). In
Praest verwendete man jedoch einen aus der Eifel importierten
Mahlstein aus Basaltlava (einen sogenannten Napoleonshut). Die Steine waren zwar schwer, jedoch mit dem
Schiff leicht an den Niederrhein zu transportieren. In der Nähe von Moers
wurde vor einigen Jahren eine ganze Schiffsladung "Napoleonshüte" in einer Kiesgrube
freigelegt.
Raum 1
/ Vitrine
3 /
Abb. 1, 2
Küche aus der
Eisenzeit
 ie Nachbildung der eisen-zeitlichen Küche beruht auf
einem Grabungsbefund von der Blouswardt, einer künstlichen Aufschüttung (Wurft) in einer Rheinaue bei
Emmerich-Praest. Die "Küche" gehört zu einem Haus der
älteren Eisenzeit (um 500 v. Chr.). Sie
bildete einen Ausschnitt aus dem Wohnteil des Hauses, der mit der Diele
verbunden und nicht durch Innenwände unterteilt war. Lediglich der Stall
wurde durch eine (niedrige) Scherwand abgetrennt. ie Nachbildung der eisen-zeitlichen Küche beruht auf
einem Grabungsbefund von der Blouswardt, einer künstlichen Aufschüttung (Wurft) in einer Rheinaue bei
Emmerich-Praest. Die "Küche" gehört zu einem Haus der
älteren Eisenzeit (um 500 v. Chr.). Sie
bildete einen Ausschnitt aus dem Wohnteil des Hauses, der mit der Diele
verbunden und nicht durch Innenwände unterteilt war. Lediglich der Stall
wurde durch eine (niedrige) Scherwand abgetrennt.
Raum 1
/ Vitrine
4 /
Abb.
2
Eisenzeitliches Grubenhaus
Grubenhaus mit Vorratsgrube aus Bedburg-Harff
um 200 v. Chr.
 rubenhäuser - kleine, halb
in den Boden eingetiefte Hütten - sind in der Eisenzeit nur selten am
Niederrhein angelegt worden. Am Mittelrhein sowie in
Hunsrück und Eifel stellten sie dagegen eine geläufige Bauform dar.
Erst um Chr. Geburt findet man sie auch
auf den Höfen des unteren Niederrheins (z.B. in der Siedlung von
Vreden) und im weiteren norddeutschen Raum. Das Bedburger Grubenhaus ist
deswegen ein frühes Beispiel für das Vordringen dieser Bauform nach
Norden. rubenhäuser - kleine, halb
in den Boden eingetiefte Hütten - sind in der Eisenzeit nur selten am
Niederrhein angelegt worden. Am Mittelrhein sowie in
Hunsrück und Eifel stellten sie dagegen eine geläufige Bauform dar.
Erst um Chr. Geburt findet man sie auch
auf den Höfen des unteren Niederrheins (z.B. in der Siedlung von
Vreden) und im weiteren norddeutschen Raum. Das Bedburger Grubenhaus ist
deswegen ein frühes Beispiel für das Vordringen dieser Bauform nach
Norden.
Dargestellt ist im unteren Bereich der Wand ein Querschnitt durch
den Befund bei der Ausgrabung und im oberen Wandbereich eine
Rekonstruktion des Grubenhauses.
1 moderner Ackerboden
2 eisenzeitlicher Füllboden mit Scherben und anderen Kulturresten
3 Lehmschicht am Boden des Grubenhauses
4 Pfostengrube
5 Zersetzungshorizont des Lösbodens mit geringem Kalkanteil
6 gelber, kalkreicher Löß
Die eisenzeitliche Geländeoberfläche lag im Bereich des modernen
Ackerhorizontes.
A
spätrömischer Trinkbecher mit Angabe des Besitzers: ORILLIO

|
|