|
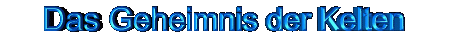
Eine Ausstellung des Limburgs Museum Venlo und des
Rijksmuseums van Oudheden Leiden
im
Museum Burg Linn
Teil
2
 22
Handel internationale Kontakte 22
Handel internationale Kontakte
 23
Handel internationale Kontakte 23
Handel internationale Kontakte
 24 Handel
internationale Kontakte
24 Handel
internationale Kontakte
 25 Waffen 25 Waffen
 26
Opfer
26
Opfer
 27
Opfer
27
Opfer  28 Opfer
28 Opfer
 29
Grabbeigaben
29
Grabbeigaben
 30 Tempel von Empel
30 Tempel von Empel
 31
Religion 31
Religion
 32
Keltische Namen 32
Keltische Namen
 34 Das
keltische Erbe 34 Das
keltische Erbe
 35 Wie
waren die Kelten bekleidet 35 Wie
waren die Kelten bekleidet

Einige Funde lassen sich nur schwer deuten, so wie diese Gesichtsmaske
aus Middelstum. Hat sie etwa mit Religion oder Kult zu tun oder oder
wurde sie nur hergestellt, um andere damit zu belustigen?
Linke Maske Original. Rechts gespiegelt.
-
22
Handel und internationale Kontakte
ca. 825 v. Chr. - 0

|
|
|
|

|
|
|
|
Mahlstein |
|
Runder Mahlstein, Eschweiler-Lohn (Deutschlan) |
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
Sichel |
|
Silexsichel (FEuerstein), Andijk (Niederlande) |
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
Marne-Keramik |
|
Nachahmung Marne-Keramik, Haren (Niederlande) |
|
|
|
|
|
|
|

-
23
Handel und internationale Kontakte
ca. 475 v. Chr. - 100 n.
Chr.
|
|
|
|

|
|
|
|
Eisendolch |
|
Eisendolch, Import aus Nordfrankreich, Havelte (Niederlande) |
|
|
|
|
|

-
24
Handel und internationale Kontakte
ca. 475 v. Chr. - 100 n.
Chr.
1 Silbervase, Neerharen (Belgien). Diese silberne
Vase wurde bei Wasserbauarbeiten in Neerharen geborgen.
Florale und geometrische Verzierungen verraten
griechische und römische Einflüsse. Es ist dennoch
denkbar, das sie in Gallien
hergestellt wurde. Die Unterseite zeigt eingekerbte Zeichen unbekannter
Bedeutung.
2 Vergoldete silberne Schmuckscheibe aus Helden.
Um 1840 fand ein Torfstecher bei
Helden in den Niederlanden
diese vergoldete Silberzierscheibe (450
v. Chr.-1 00 n. Chr.), die möglicherweise aus
Thrakien stammt. Sie zeigt einen
Mann im Kampf mit einem Löwen. Er wird von weiteren Tieren (Widder
Löwe, Hund, Rind) eingerahmt. Das kostbare Objekt ist wahrscheinlich
ein Mooropfer.
|
|
|
|

|
|
|
|
Silbervase |
|
Silbervase, Neerharen (Belgien) |
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
Schmuckscheibe |
|
Vergoldete Schmuckscheibe aus Helden (Niederlande) |
|
|
|
|
|
|

Riten und Gewalt
 as
Opfer nahm in der keltischen Welt
eine zentrale Position ein. Quellen, Moore, Seen,
Bäche und Flüsse waren bevorzugte Opferplätze. as
Opfer nahm in der keltischen Welt
eine zentrale Position ein. Quellen, Moore, Seen,
Bäche und Flüsse waren bevorzugte Opferplätze.
In Gebirgsgegenden nutzte man auch Grotten. An solchen
Opferplätzen schenkte man den Gottheiten in teilweise großen Mengen
wertvolle Objekte und Waffen. Hierbei machte man die Waffen häufig
unbrauchbar. In selteneren Fällen wurden auch Menschen geopfert. So fand
man z.B. in Nordfrankreich die Leichen besiegter Krieger zwischen
geopferten Waffen. Art und Form der Kultplätze sind sehr
unterschiedlich, so gibt es eingehegte, rechtwinkelige oder rund
angelegte Freiluftheiligtümer, Grabgärten und Opferplätze. Mit Beginn
der Römerherrschaft entstehen hieraus häufiger Tempelkomplexe mit
steinernen Tempelgebäuden, die sich aber in ihrer Kultstruktur von den
herkömmlichen römischen Anlagen
unterscheiden, ein Hinweis darauf, das alte Glaubensinhalte erhalten
bleiben. 
-
25
Waffen ca. 450 v. Chr. - 0
|
|
|
|

|
|
|
|
Schwerter |
|
Schwerter, Kessel/Lith (Niederlande), aus der Schelde: Antwerpen und unbekannter Fundort (Belgien) und Roermond (Niederlande) |
|
|
|
|
|

-
26
Opfer ca. 825 v. Chr. - 0
|
|
|
|

|
|
|
|
Halsringe |
|
Halsringe, Bonn (Deutschland), Onstwedder Barlge (Niederlande), Oudenaarde (Belgien) |
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
Armbänder |
|
Armbänder, Doorwerth (Niederlande) |
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
Halsring und Armbänder |
|
Halsring und Armbänder, Doorwerth (Niederlande) |
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
Armband |
|
Armband, Wessem (Niederlande) |
|
|
|
|
|
|

-
27
Opfer ca. 475 v. Chr. - 150 n. Chr.
|
|
|
|

|
|
|
|
Schädel |
|
Schädel mit Gewaltspuren, Kessel/Lith (Niederlande) |
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
Beile |
|
Bauopfer von Beilen aus Stein, Oss und Meteren Niederlande |
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
Tonmasken |
|
Tonmasken, Maastricht-Caberg und Middelstum (Niederlande). Diese Masken zeigen ein stilisiertes menschliches Gesicht. Die genaue Funktion ist nicht geklärt. Denkbar wäre eine Verwndung im Kulturbereich, |
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
Panflöte |
|
Fragment einer Panflöte, Nimwegen-Oosterhout (Niederlande) |
|
|
|
|
|
|

-
28
Opfer ca. 200 v. Chr. - 100 n. Chr.
|
|
|
|

|
|
|
|
Perlenkette |
|
Perlenschnur aus Bernstein, Empel (Niederlande) |
|
|
|
|
|

-
29
Grabbeigaben ca. 475 v. Chr. - 0
|
|
|
|

|
|
|
|
Schale |
|
Schale Typ Braubach, Hamminkeln-Düne Tebbe (Deutschland) |
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
Grabinhalt |
|
Grabinhalt Beinringe, Wesseling (Deutschland) |
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
Grabinhalt |
|
Grabinhalt Topf, Wesseling (Deutschland) |
|
|
|
|
|
|
|

-
30
Der Tempel von Empel, Niederlande ca. 100 n. Chr.
|
|
|
|

|
|
|
|
Schildbuckel |
|
Schildbuckel (zum Schutz der Hand auf dem Hölzenen Schild befestigt) |
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
Schamiere |
|
Schamiere vom Brustpanzern |
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
Siegelkapsel |
|
Siegelkapsel (zur Versiegelung von Wachstafelbriefen und Dokumenten) |
|
|
|
|
|
|
|

Besiegt und besetzt
 ach
zähem Kampf besetzen die Römer das
Gebiet zwischen belgischer Nordseeküste und Rhein. Durch
Abkommen und Bündnisse mit den lokalen Herren, gelingt es ihnen die
Gebiete wirksam zu kontrollieren. Die örtlichen Herrscher erlangen im
Laufe der Zeit wichtige Ämter in einer Gesellschaft, die schnell
römische Züge annimmt. ach
zähem Kampf besetzen die Römer das
Gebiet zwischen belgischer Nordseeküste und Rhein. Durch
Abkommen und Bündnisse mit den lokalen Herren, gelingt es ihnen die
Gebiete wirksam zu kontrollieren. Die örtlichen Herrscher erlangen im
Laufe der Zeit wichtige Ämter in einer Gesellschaft, die schnell
römische Züge annimmt.
Die Bevölkerung übernimmt nach und nach die
römische Lebensart, doch bleiben einige Traditionen erhalten.
Auch die Römer passen sich an und
lassen das Althergebrachte oft intakt.
Keltische Götter werden übernommen und auch im Tempelbau
lassen sich einheimische Einflüsse erkennen.
-
31
Religion ca. 100 n. Chr. - 100 n. Chr.
|
|
|
|

|
|
|
|
Statue |
|
Statue der Pferdegöttin Epona gewidmet, Baarlo (Niederlande) |
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
Statue |
|
Statue einer Muttergöttin, Nimwegen (Niederlande) |
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
Statue |
|
Matronenstatue aus Pfeifenton, Bonn und Krefeld |
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
Statue |
|
Matronenstatue aus Pfeifenton, Bonn und Krefeld
|
|
|
|
|
|
|

-
32
Keltische Namen ca. 100 n. Chr.
|
|
|
|

|
|
|
|
Topf |
|
Topf mit dem Namen BOVDI, Nimwegen (Niederlande) |
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
Bronze |
|
Hahn aus Bronze, mit Einlage aus Email mit dem Text: DEAE ARCANVE VLPIVS/VERINVS VETERANVS LEG VI V.S.L,M. |
|
|
|
|
|
|

Lebensbild eines
Römischen Soldaten
 er
römische Soldat ging gut ausgebildet
und gerüstet in den Kampf. Obwohl er oft in Unterzahl antrat, verhalfen
ihm die bessere Organisation und Taktik meist zum Sieg. Die Truppen
bewegten sich zu Fuß durch das Reich. Über das zweckmäßige
Straßennetz ging das recht schnell. Die
Legionäre mussten aber ihre eigene Ausrüstung tragen. Sie wog
40 kg, ein Gewicht unter dem heute mancher zusammenbrechen würde. er
römische Soldat ging gut ausgebildet
und gerüstet in den Kampf. Obwohl er oft in Unterzahl antrat, verhalfen
ihm die bessere Organisation und Taktik meist zum Sieg. Die Truppen
bewegten sich zu Fuß durch das Reich. Über das zweckmäßige
Straßennetz ging das recht schnell. Die
Legionäre mussten aber ihre eigene Ausrüstung tragen. Sie wog
40 kg, ein Gewicht unter dem heute mancher zusammenbrechen würde.

Das keltische Erbe
 ieles
aus der keltischen Kultur löst sich
im Verlauf der römischen Herrschaft
auf. In den nicht von Römern
besetzten Gebieten bleiben jedoch Traditionen und Lebensweisen erhalten
und können sich eigenständig weiterentwickeln. Spuren hiervon findet man
in Irland und Schottland. Die Kelten
wurden jedoch erst in der Zeit der Renaissance, im
16. Jahrhundert, wieder entdeckt.
Die Berichte der römischen
Schriftsteller sind nicht sehr klar, so dass vieles hinzu erfunden
wurde. Während der Romantik, im
ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhundert, erreichte dies
einen Höhepunkt. Man entdeckte keltische
Geschichten und gründete Druidengesellschaften. Die
Kelten rückten wieder in den
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und bleiben es bis heute. ieles
aus der keltischen Kultur löst sich
im Verlauf der römischen Herrschaft
auf. In den nicht von Römern
besetzten Gebieten bleiben jedoch Traditionen und Lebensweisen erhalten
und können sich eigenständig weiterentwickeln. Spuren hiervon findet man
in Irland und Schottland. Die Kelten
wurden jedoch erst in der Zeit der Renaissance, im
16. Jahrhundert, wieder entdeckt.
Die Berichte der römischen
Schriftsteller sind nicht sehr klar, so dass vieles hinzu erfunden
wurde. Während der Romantik, im
ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhundert, erreichte dies
einen Höhepunkt. Man entdeckte keltische
Geschichten und gründete Druidengesellschaften. Die
Kelten rückten wieder in den
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und bleiben es bis heute.

|
|
|
|

|
|
|
|
Kelte |
|
Rekonstruktion eines Kelten aus dem 19. Jahrhundert |
|
|
|
|
|

Römischer Matronenaltar ca. 100 n. Chr.
Römischer Text:
MAT(RONIS) OCTOCANNIS
Q(VINTVS)IVL(IVS) QVIETVS
ET(I)VVCVNDVS ET VRSVLVS
IMP(ERIO) IPS(ARUM) L(IBENS)
M(ERITO)

|
Römischer Matronenaltar (ca.
100 n. Chr.) |
Übersetzung: Den Matronen von Octocannae von Quintus
Julius Quietus, Jucundus und Ursulus auf Befehl der Göttinnen selbst
gewidmet, gerne und nach Gebühr, Ossum-Bösinghoven, Deutschland
Gibsabdruck einer in einer Mergelgruppe eingekrazte
Kultfigur, Mastrich-Trichterveld, Niederland.
Die Gravur mit betotem Phallus. Die Darstellung wird mit keltischen
Vorbildern verglichen und datiert möglicherweise in römische Zeit.
-
35
Wie waren die Kelten
bekleidet?
Projekte zur lebendigen
Geschichte e. V.
Eine Duisburger Gruppe von Darstellern welche bei der
Ausstellungseröffnung keltische Bekleidung vorstellte.
Beschreibung der Textilien von Sylvia Crumbach.
|
|
|
|

|
|
|
|
Hallstattzeitliche Männertracht |
|
Hallstattzeitliche Männertracht. Blaue Tunika aus Wolle mit ¾ Ärmeln nach mediterranen Vorbild. Gelber Prachtmantel mit brettchengewebten Zierborten. Gürtel aus Leder mit einem breiten Gürtelblech. Eisendolch mit Bronzegriffe (Typ Heuneburg) mit Korallenverzierungen. Zusammenstellung nach süddeutschen Funden.
2. Hälfte 6. Jahrh. v. Chr.
Darsteller: Heinz-Peter Crumbach
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
Hallstattzeitliche Frauentracht |
|
Hallstattzeitliche Frauentracht. Kräftig gelber Rock aus Wolle und eine Tunika aus feinem Leinen mit brettchengewebten Verzierungen.
Das Schleiertuch aus feinster Wolle wird an einer Frisur mit aufgesteckten Zöpfen mit 16 Nadeln aus Bronze gehalten.
Um die Taille wird ein breiter Gürtel mit einem Gürtelblech aus Bronze getragen. Haarnadeln und Gürtelblech nach Süddeutschen Funden.
2. Hälfte 6. Jahrh. v. Chr.
Darstellerin: Silvia Ungerechts
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
Hallstattzeitliche Schnabelschuhe |
|
Rekonstruktion späthallstattzeitlicher Schnabelschuhe. Leder-Anfertigung nach etruskischen Abbildungen und Hinweisen aus süddeutschen Funden.
Darsteller: Heinz-Peter Crumbach |
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
Ostkeltische Männertracht |
|
Ostkeltische Männertracht (Skordisker) 2. v. Chr. Tunika, Hose und einfacher Rechteckmantel aus Wollstoff. Rekonstruktion nach verschiedenen Funden. Beschreibungen und Abbildungen
Nils Bross. Treverische Männertracht nach dem Grabstein des Rheinschiffers Blussus (Trier). Tunika, Hose und Kapuzen-Cape aus Wollstoff.
Darsteller: Malte Schmiedecke |
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
Germanische Tracht |
|
Eine Germanische Tracht mit spätkeltischen Einflüssen. Roter Peplos mit Untertunika aus weißem Leinen Fibel und Gürtelkette nach einem Fund aus Nüssau, Kr. Herzogtum Lauenburg.
1. Hälfte 1. Jahrhundert n. Chr.
Darstellerin: Sylvia Crumbach
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
Romanisierte Ubier |
|
Romanisierte Uberier (CCAA, Köln). Männertracht bestehend aus weißer Woll-Tunika mit Clavi. Karierter Rechteckmantel mit verzinnter Bronzefibel. Römische Schuhe Sandy Piel.
Frauentracht Peplos aus feinem Wollstoff mit Fibeln auf denSchultern gehalten. Palla aus feinster hellblauer Wolle. Römischer Goldschmuck. Manuela Hanke.
Hintergrund Darstellerin: Sylvia Crumbach
|
|
|
|
|
|
|
|
Textilverarbeitung in der Eisenzeit
Ein Forschungsbeitrag von Sylvia Crumbach
 
Ergebnisseite:
1 2 vorwärts
Für die Genehmigung zur Veröffentlichung der Texte
und Fotos, bedankt sich der Verf. beim Museumsdirektor vom Museum
Burg Linn Dr. Christoph Reichmann.
zurück zu News |